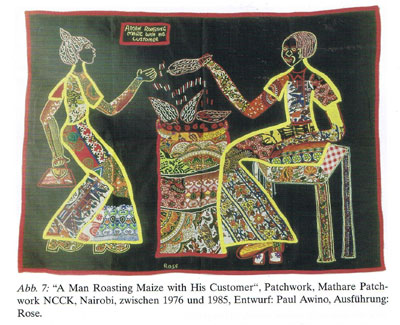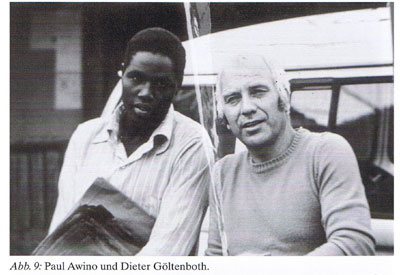Inhalt:
Werner Scheel
Göltenboths Arbeit überrascht.
Welchen Grund kann man angesichts der Fülle zeitgenössischen Angebots noch haben, um von Überraschung zu reden?
Die hier verwendete Technik der Materialmontage ist nicht Göltenboths Erfindung. Das Einbeziehen von Materialien, die von Maschine oder Hand bearbeitet waren, ist ebenso wenig neu wie der Griff nach Fundsachen.
Ursache des Aufmerkens ist vielmehr die Besonderheit der Aussage, die hier mit den eben genannten Mitteln erreicht wird.
Aus dem Abfall von Strand und Straßenrand entstehen Bildwerke, deren Elemente nicht ästhetische Zugabe im Sinn von Gags sind. Die ins Auge springenden Verfallsstrukturen abgelebter Dinge wie Puppenteile, verkohlte Hölzer, Knochen usw. werden nicht nur durch formal-konstruktive Beherrschung des Integrationsprozesses zur Ansprache. Sie erfüllen in dem offensichtlichen Ordnungszusammenhang eine ungemein expressive Funktion.
Hier besteht die Fähigkeit, Schicksalhaftes mitzuempfinden und zu gestalten.
Der Verfall wird auf eine Weise ernst genommen, dass das spürbare Gefasstsein nicht auf Gleichgültigkeit, sondern auf Vertrautheit gründen kann.
Weil solche Vertrautheit zudem mit urwüchsiger Vitalität gepaart auftritt, entsteht Überraschung. Denn solches ist selten.
(1970)

Hans Brög
Zweierlei erscheint mir besonders erwähnenswert an den Arbeiten D. Göltenboths. 1. Das Repertoire, über dem diese Arbeiten selektiert werden und 2. die semantische Botschaft, die sie transportieren. Selbstverständlich sind diese beiden Aspekte, der der Produktion und der Konsumation für jedes ästhetische Objekt, für jeden Träger von Information erheblich, denn geht es doch schließlich bei Kommunikationsprozessen immer darum, dass ein Informationen tragendes Medium spezieller Eigenart von einem Expedienten, in diesem Fall von D. Göltenboth, einem Perzepienten, einem Betrachter, angeboten wird. Trivial wäre es, anhand der so und nicht anders seienden Kunst Göltenboths über allgemeine Bedingungen der Vermittlung ästhetischer Botschaften zu sprechen. Nicht trivial ist es, um zu 1. zurückzukehren, über das spezielle Göltenboth’sche Repertoire zu schreiben, das seine Objekte konstituiert. Verfährt man chronologisch bei der Betrachtung der Exponate Göltenboths, einsetzend bei den frühesten, endend mit den jüngst kreierten, so verfolgt man einem Weg vom Fundstückagglomerat, vom Ensemble partikulärer “ready mades” quasi, zum Objekt aus gekauften Halbfabrikaten, von Zivilisationsabfällen (von Knochen etc. abgesehen), die aus ihren ersten Zweck, dem sie einst dienten, kaum preisgeben, zu Materialien, die noch keine Vergangenheit verraten. “Sie sind zu lange im Wald geblieben”, die “ready mades” nämlich, könnte man mit M. Ernst sagen, zu lange aber auch am Strand, in der heißen Sonne Ibizas, zu lange der Natur ausgesetzt, so dass die Prozesse dieser Natur ihre Spuren hinterließen. Spuren, die auf das Chaos verweisen, dem Naturprozesse stets Vorschub leisten. Spuren, die anders sind als die, die der homo sapiens hinterlässt, sei es als Künstler oder Ingenieur. Interessant ist es, konstatieren zu können, wie Göltenboth, der zunächst aus einem chaotischen Großrepertoire auswählt, dann über das Repertoire der Abfälle einer Schreinerwerkstatt, die vorübergehend zu seiner existentiellen “Geworfenheit” gehörte, zu einem ungleich engeren Repertoire fand. Zuletzt kauft er, was er zur Realisation seiner Kreationen benötigt. Zweifellos ein Indiz für größere Antizipationsfähigkeit von Seiten des Autors. Ein Indiz für einen stattgefundenen Lernprozess. Göltenboth hatte sich zunächst Objekte, Denkmodelle gewissermaßen herschaffen, die er selbst erst erforschen, für sich selbst erst hochredundant machen musste (was so viel heißt wie “lernen”), was dann, mit dem Gelernten als Voraussetzung zu neuen, bewussteren, das Alte integrierenden Objekten führte.
Zu 2.:
Kennt man spätestens seit es die “konkrete Kunst” gibt mit ihr eine Kunst, die approximativ semantische Leere erreicht, so kennt man in unseren Tagen auch ästhetische Objekte semantischer Überladung. Die Forderung nach “gesellschaftlicher Relevanz” in der Kunst hat eben ihre Extreme gezeitigt. Auch die Göltenboth’sche Kunst zeigt gesellschaftliche Relevanz. Nicht aber, weil sie der Forderung danach Folge zu leisten bemüht ist. Im Repertoire schon, im von der Gesellschaft hinterlassenen Zivilisationsmüll, liegt gesellschaftliche Relevanz begründet. Das einzelne Detail schon tritt uns als memento mori gegenüber, wenn auch nicht im Sinne des Barock. Eine Steigerung erfährt dieser Aspekt durch die Arrangements der einzelnen Elemente, durch ihre syntaktischen Bezüge, durch ihre Superisationen. Es entstehen Gehäuse, Kolosse, Figurinen, assoziativ zwar nur, aber doch unsere Interpretationsmöglichkeiten lenkend, einschränkend. Diese Kodierungen von Inhalten sind Metaphern, “Wegzeichen nach Innen” (1969), “Sphinx der Müllhalden” (1969), “Vanitas” (1971). Es sind Namen zwar, aber keine Symbole nur, nicht Zeichen, die sich zufällig, beliebig zu ihren Objekten verhalten, sondern auch indexikalischen Anspruch geltend machen. “Wegzeichen nach Innen” zeigt an, worum es D. Göltenboth geht: Nicht primär um das Faktische, effektiv Feststellbare des Objekts, sondern um das “Verbaute, Vernagelte, Verstellte”, um einige Termini D. Göltenboths zu gebrauchen, um das, was “dahinter” steht. Ja auch das gehört zu den ästhetischen Objekten D. Göltenboths, als interpretationsbedürftiges Korrelat zur effektiven Materialität. Auch die “Sphinx der Müllhalden” wird auf dieser Basis zum Hinweis. Die Puppe, das Abbild, Ikon des Menschen wird durch Amputationen zum Index des mehr und mehr fragilen Menschen der Zukunft, zugleich aber auch zum Ikon des bereits schon jetzt nicht mehr intakten Menschen unserer Tage. Es werden Reflexionen darüber in Gang gesetzt, was der Mensch (in seinen weitesten Kontexten) war, ist und sein wird. Darin entdecke ich die gesellschaftliche Relevanz der Göltenboth’schen Kunst. Romantisches fast spielt herein. Wie in jener Epoche wird Aussage versucht über Gebiete am Rande des menschlichen Begriffsvermögens. Deshalb muss mancher Inhalt metaphorisch, hieroglyphisch bleiben. Das materielle Repertoire ist eindeutig bestimmt, mehr und mehr eindeutig in den jüngsten Arbeiten. Das semantische Repertoire hingegen ist multiinterpretabel.
Zerstörungen intakter Konstellationen und Ordnungen werden mit Vehemenz vorangetrieben, dadurch ihrer konventionellen Bedeutungen sensibilisiert. Das geschieht zuweilen mit Feuer (in doppelter Sinnbedeutung) und Eifer. Das geschieht mit Lust und Freude. Epikureisch eigentlich. Eine Stimulans, die stets schon tauglich war zur Produktion von Kunst.
(Vermessung des Irrationalen, 1971)

Reinhard Döhl
Vermutungen über Schiffe, Feuerstellen, Inseln und die Materialbilder s
Wer einmal in Norddeutschland und Dänemark seine Ferien auch dazu genutzt hat, sich mit den Spuren der Wikinger vertraut zu machen, wird in Haitabu die Einbäume sowie Teile eines Langschiffs besichtigt haben. Doch wird seine Spurensuche erst auf dem Gräberfeld im dänischen Lindholm Høje und dann abgeschlossen sein, wenn er auch die schiffsförmigen Steinkreise gesehen hat, mit denen dort viele Gräber umgeben sind. Das Schiff hatte also für die damaligen Menschen eine Bedeutung bis über den Tod hinaus.
Wer einmal in Ägypten Museen und/oder die Pyramiden von innen besichtigt hat, wird sich an zahlreiche Scheintüren erinnern, die sich konkret nicht durchschreiten lassen, die ein Toter dennoch passieren konnte, wenn die Türwärter der [ägyptischen] Unterwelt ihn passieren ließen. Dazu bedurfte es bestimmter Voraussetzungen, vor allem der Kenntnis von Texten, die man den Toten deshalb mit ins Grab gab und die uns heute vor allem aus dem "Totenbuch" vertraut sind. Natürlich spielt auch bei den alten Ägyptern, in der Realität wie im Totenkult, das Schiff, die Barke eine besondere Rolle.
Ich wollte mit dem Gesagten keinen Ausflug in Volkskunde und Religionsgeschichte gemacht haben, sondern zu einem künstlerischen Werk hinführen, dessen Arbeiten vor diesem Hintergrund verständlicher werden. Wobei ich einmal an eine von Dieter Göltenboth "Ausgang und Eingang" getitelte Arbeit denke, auf der neben einer allenfalls ideel zu durchschreitenden Tür links wie rechts jeweils ein Türwärter sich befindet.
Die zweite Arbeit, auf die ich mich beziehe, ist ein frühes Werk aus dem Jahre 1964 mit dem Titel "Nachen des Charon", das bereits mit seinem Titel auf einen weiteren Mythenkreis, die griechische Mythologie verweist. Wobei auch hier das Schiff wiederum in Realität und Totenkult eine besondere Rolle spielt.
Eine dritte Arbeit, auf die ich zunächst nur verweise, "Moby Dick", sprengt diesen Bezugsrahmen nur scheinbar und verbindet ebenfalls die Themen Tod und Leben. Denn Melvilles berühmter Roman endet zwar mit dem Untergang des Walfängerschiffes, seines unheimlichen Kapitäns und der Besatzung, läßt aber den Erzähler und Walfänger Ismael, der sich an den Sarg seines Harpuniers, des Polynesiers Queequec klammert, das Massaker überleben.
Nimmt man hinzu, daß mit "Nachen des Charon" jener Fährmann benannt wird, der die Toten über den Grenzfluß (Styx oder Acheron) der Unterwelt (Hades) setzt, wird sich der Betrachter fragen müssen, wie die literarischen und mythologischen Anspielungen aufzulösen sind.
Was hier angesichts des umfangreichen Werks Dieter Göltenboths, das neben Materialbildern und gewichtigen Installationen auch Gedichte und dokumentarische Fotos umfaßt, zu sagen wäre, sprengt die Möglichkeiten eines Katalogbeitrags. Ich beschränke mich deshalb auf drei zentrale Themenkomplexe: den Komplex Schiff, das Thema Feuerstelle, was die Steinobjektbilder und -installationen mit einschließt, sowie den Schwerpunkt Ibiza, der sich allgemeiner mit Insel überschreiben ließe, um bereits im Vorfeld anzudeuten, daß Ibiza für Dieter Göltenboth weniger eine Ferieninsel als eine gedankliche Projektion ist.
Bereits 1964 - vorausgegangen waren längere Aufenthalte auf Ibiza, Reisen in Afrika, und danach erst ein Abschluß des Kunsterzieherstudiums - schlägt Dieter Göltenboth mit dem "Nachen des Charon" erstmals das Thema Schiff in Verbindung mit Tod und Unterwelt an. Zwar zeigt die Arbeit nur den Nachen, gleichsam in seinem Gerüst und durch die angebrannten Holzspitzen bedrohlich wirkend, aber der Fährmann ist über den Titel durchaus im Bewußtsein des Betrachters, der ja aus der Mythologie weiß, daß es dieses Fährmanns bedarf, um überzusetzen.
Diese Arbeit Dieter Göltenboths findet eine interesssante Parallele im Werk Günter Eichs, der immer dort, wo er auf seinen Heimatfluß, die Oder, zu sprechen kommt, auch den Fährmann bemüht. In mythologischer Anspielung in einer Hörfolge "Der Strom" [1950], in der es zunächst beruhigend heißt:
Steig ein in das heitere Boot, es ist nicht die Charonsfähre,
du selbst hast die Planken in deinem Traume gezimmert.
Sie halten. Der Kiel berührt kaum die Strömung.
Zaudere nicht, sieh, die Welle, die Stunde verrinnt,
während am anderen Ufer das Leben dich wilder erwartet.
Willst du zurück nicht in die Mühen landeinwarts,
wage dich über den Strom. Sieh, alles Geträumte,
drüben ist es Wirklichkeit; die Farben sind tiefer,
die Freuden ohne Ernüchterung. Eines nur fehlt:
der Kummer. Steig ein!
Später jedoch wird es es dann heißen:
Im Nebel ertastet der Uferrand.
Wellen lautlos die Füße benetzen.
Wie breit ist der Strom? Kein Drüben bekannt.
Jemand führt dich an seiner Schattenhand
und heißt in den Nachen dich setzen.
Und plötzlich erkennst du das Nebelland,
weißt die Breite des Stromes zu schätzen
und weißt, wer dich führte an seiner Hand
und mit dem Ruder im Nachen stand
und du nennst ihn ohne Entsetzen.
Anders als Eichs Hörfolge vermittelt der "Nachen des Charon" zunächst noch Bedrohliches. Aber dieses Bedrohliche schwächt sich ab in einem Gedicht, das am 20. September 1975 in Devon notiert hat:
Die Stadt, in der ich wohne,
hat keine Tore,
ihre Fenster sind blind,
ihre Straßen geschlossen.
[...]
Unten steht der Fluß,
moosig,
alt,
ein Stück zerbrochenes Glas.
Der Fährmann wartet im Nachen.
Zögernd folge ich seiner Einladung.
[...]
Während ich im Boot
den Fluß überquere,
liegt sie [die Stadt, R.D.] im Zwielicht,
unter dem stürzenden Himmel
ganz still.
Aber nicht nur die Mehrdeutigkeit, mit der Günter Eich und Dieter Göltenboth Nachen, Boot, Fährmann besetzen, macht sie vergleichbar, auch der Vorgang, um den es in beiden Fällen geht, das Übersetzen, ist bei beiden vergleichbar mehrdeutig. Schon im Lateinischen bezeichnet das Verb transferre sowohl das Übersetzen über ein Gewässer als auch das Übertragen von einer in eine andere Sprache. Wobei die deutsche Sprache im mündlichen Gebrauch durch die Betonung den Unterschied deutlich macht: übersetzen und übersetzen.
Diese Doppeldeutigkeit des Übersetzens spielt bei Günter Eich eine zum Verständnis seines Werkes zentrale Rolle, aber auch - dies meine These - im Werk Dieter Göltenboths, indem er einmal übersetzen thematisiert in Arbeiten wie dem "Nachen des Charon" oder "Moby Dick"; aber auch in Fotos, die er auf Ibiza von Schiffwracks gemacht hat, um so auch die Frage zu fixieren: Was trägt uns? beziehungsweise: Trägt uns das, was uns trägt, und wieweit und wohin? Eine Frage, die sich eingedenk der Tatsache, daß der Schiffsbau eine zivilisatorische Leistung ist, auch so stellen ließe: Trägt uns (heute noch) die Zivilisation und wieweit und wohin?
Schließlich wird das Schiff und mit ihm das Übersetzen bei Dieter Göltenboth aber auch dort noch thematisiert, zumindest angespielt, wo seine Installationen schiffsähnliche Umrisse aufweisen, etwa bei einem "Erdmal" aus dem Jahre 1987, bei dem Grenzen zum Thema Insel fließend sind.
Von übersetzen möchte ich im Falle Dieter Göltenboths dann und dort sprechen, wo er Mythologie, Literatur oder auch eigene Gedanken ins Bild übersetzt, Bild werden läßt als "Nachen des Charon" oder "Moby Dick". Daß dieses Übersetzen nicht im Sinne von Illustrieren mißverstanden werden darf, erhellt schon aus der Tatsache, daß Dieter Göltenboths Materialbilder (und -installationen) ihr Material nicht bearbeiten sondern nur ordnen, worauf der Künstler bereits 1969 in einer Ausstellungsnotiz nachdrücklich verwiesen hat:
In diesen [...] Arbeiten [...] war das Ausgangsmaterial angeschwemmter Zivilisationsschutt aller Art, Bretter, Keile, Kreisformen, Bleche, Puppenteile, zusätzlich verarbeitet mit Gips.
Ich habe diese Dinge zu Ordnungen arrangiert, die meiner Vorstellung von Welt und Dasein entsprechen.
Alles weitere läßt sich nicht sagen. Sie können es den Arbeiten entnehmen.
Das Anordnen der Fundstücke, des aufgelesenen Zivilisationsschutts wäre demnach die Sprache, in die der Künstler seine Vorstellung von Welt übersetzt. Daß dieses Übersetzen zugleich ein Tranformationsprozeß ist, wird deutlich, wenn man den Zivilisationsschutt durch das Hegelsche Prosa der Welt ersetzt. Denn diese Prosa der Welt kontrastiert der Poesie der Kunst und verweist auf eine Polarität, die uns seit der frühen Romantik geläufig ist, eine Kunstauffassung und Tradition, der sich Dieter Göltenboth durchaus verpflichtet weiß, wenn er gesprächsweise zum Beispiel auf Caspar David Friedrich verweist, dessen "Gescheiterte Hoffnung" mich wieder zum Thema Schiff zurückbringt, konkret zu "Moby Dick".
Gerade an diesem Materialbild läßt sich die Frage: Was trägt uns und trägt uns das, von dem wir denken, daß es uns trägt? bzw. die Übersetzung dieser Frage ins Bild recht gut diskutieren.
"Moby Dick" besteht ausschließlich aus Resten von Schiffsholz, also Wrackholz in einer Anordnung, die auf den ersten Blick Schiff assoziiert, dabei aber, der Weltsicht des Künstlers entsprechend, das Schiff nurmehr als Wrack zuläßt. Im Übersetzungsvorgang steht dieses Schiffskelett einmal für das Walfängerschiff des Romans. Zum anderen steht es gleichgewichtig durch seine eingeweißten Teile für das Objekt der Walfangexpedition, den weißen Wal Moby Dick. So eindeutig wie bei anderen zeitgenössischen Materialfetischisten geht es bei Dieter Göltenboth nicht zu.
Um Göltenboths Übersetzung zu verstehen, ist es sinnvoll, sich des berühmten Romans von Herman Melville zu erinnern. Er erzählt die Geschichte eines versuchten Walfangs, eines Walfängers unter Kapitän Ahab, für den die Fahrt ein persönlicher Rachfeldzug gegen den Weißen Wal ist. [Auf die Gründe und den hintersinnigen Namen des Kapitäns muß ich hier nicht näher eingehen.] Als der Weiße Wal schließlich gesichtet und gejagt wird, zerstört er den Walfänger und zieht, von Ahab harpuniert, den Kapitän mit sich in die Tiefe. In meiner Lesart bleibt offen, ob der Wal überlebt oder nicht. Mit Sicherheit aber überlebt der Erzähler Ismael [bei Melville: Ishmael], der sich an den Sarg seines Harpuniers Queequec klammert, bis er von der Besatzung eines anderen Schiffes vollends gerettet wird.
Wenn Melville seinen Erzähler Ismael nennt, benutzt er, wie im Falle Ahabs, einen Namen des Alten Testaments, das Ismael als Sohn Abrahams kennt, der nach der Geburt Isaaks verstoßen wird, also aus dem gesellschaftlichen Gefüge [im Sinne Melvilles: aus der Zivilisationsordnung] ausgestoßen ist. Dafür teilt er aber in Melvilles Augen auch nicht die Zivilisationskrankheit der schrecklichen Vereinfachung des Wirklichen. Sein Ismael sieht in der Welt nicht nur die Erhabenheit, sondern auch die Wunden und Schrecken Gottes, kennt neben der mystischen Versenkung in die Schönheit der Natur und ihre Ordnung auch den panischen Schrecken vor ihrer zerstörerischen Gewalt. So sieht er im Falle des Wals, dessen Farbe ein ganze Kapitel ("The Whiteness of the Whale") gewidmet ist, das Feierliche, aber eben auch das Unheimliche der Farbe Weiß. Entsprechend ist Ismael Haltung gegenüber der Welt nicht ausgeglichen und gelassen, sondern sie schwankt zwischen Skepsis und Fatalismus, ebenso bereit, zu fragen und praktische Erfahrungen zu machen wie in die Dinge und Ereignisse einzutauchen.
Für mich läßt sich zwischen dieser Haltung des zivilisatorischen Außenseiters Ismael und der Position des modernen Künstlers eine Parallele herstellen, ist es kein Rätsel, wenn das Materialbild "Moby Dick" sich aus Wrackhölzern zusammensetzt und in seiner weißen Einfärbung zugleich den Wal herbeiassoziiert, dessen Jagd Melville übrigens eine weitere alttestamentarische Geschichte, die Legende von Jonas und dem Wal, kontrastiert.
Die von mir angenommene Parallele zwischen Melvilles Ismael und dem modernen Künstler ließe sich sogar recht weit treiben, was hier nur angedeutet werden kann. Ismaels Entschluß, sich den Walfängern anzuschließen beziehungsweise zunächst allgemeiner: wieder einmal zur See zu gehen, soll einer gewissen Lebensunlust und Melancholie entgegenwirken, einem Zustand, aus dem heraus häufig ja auch der moderne Künstler arbeitet. Nicht von ungefähr ist die Melancholie seit der Renaissance sein Wasserzeichen. Für Ismael sind therapeutisch immer schon Wasser und Medition verknüpft.
Das ist im Falle Dieter Göltenboths kaum anders. Seine Entscheidung für Ibiza, für das, was man in seinen Installationen Inseln nennen könnte, fände für mich von hier aus jedenfalls ebenso eine Erklärung wie zwei große Kunstprojekte, die er im Vorstand der "Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künstler" angeregt hat: das Projekt "Wasser" (1986) und das Projekt "Erde Zeichen Erde" (1993).
Wenn ich jetzt auf die "Feuerstellen" und "Erdmale" zu sprechen komme, muß ich zugleich über ein neues Material, die Steine sprechen. Dieter Göltenboth hat in einen kleinen Essay, "Was zwingt mich, Ja zu sagen zur Versteinerung", seine Entscheidung für dieses Material fast existentiell begründet.
Er halte und benütze es, schreibt er dort, wie Beweise für Existenz und wie Masken für Inhalte, die unheimlich und beängstigend seien. Es ist fast so, als ob ich mir durch das Vorweisen, Anfassen und Zuordnen von Material, das aus dieser Welt stammt, das aus der Zivilisation kommt, das organisch oder mineralisch ist, beweisen müßte, daß es diese Welt, und mich in ihr, wirklich gibt.
Ein Resultat dieses Vorweisens, Anfassens und Zuordnens sind im Wald gefundene und/oder ausgegrabene Steine, die Dieter Göltenboth an Ort und Stelle zu Erdmalen ordnet und zurückläßt für vielleicht einen zufällig Vorbeikommenden als Zeichen des Dagewesenseins - ähnlich den "Feuerstellen", die Dieter Göltenboth in den 80er Jahren mehrfach und unterschiedlich installiert und sogar bespielt hat als Ort der Einfriedung mit den angesengten und zerbrochenen Stücken der "Welt", die zurückbleibt, wenn die Jäger den Braten gegessen haben, wenn die aus der Flugbahn gestürzten Vögel zu Dung geworden sind.
Es ist, fährt Dieter Göltenboth in einer hier aufschlußreichen Projektbeschreibung fort, der Ort der Glut und der Asche, das Auge, das Loch, das, was die Zeit überdauert. Die "Stelle" ist eine Insel im Meer, ein Planet im All, ein ausgewählter verlassener Garten, ein Hortus.
Der Hauch der Zeit weht aus der Glut. Die Geschichte der Evolution als geologischer Ort der Versteinerung. Ein Ort der Erinnerung, in dem die Zweifel nisten und knistern. Ein verlassener Platz. Ein leeres Denkgebäude. Ein Traum in Schwarz und Weiß. Eine Schädelstätte. Der meditative Ort einer Aschenkultur, aus der wohl nie ein Phönix steigen wird. Eher Begräbnisstätte, Landeplatz, Deponie, Entsorgung als Ort des Aufbruchs. "Stelle des Feuers" ist Melancholie, ist Aufhebung der Entwicklung, Anhalten, Einhalten, Suche nach Zeitlosigkeit, Geschichtslosigkeit, Vergessen, Zuordnen des Zeitlichen in das Unzeitliche.
Diese Projektbeschreibung formuliert natürlich die Sicht des Künstlers, den komplexen Anstoß zu seinen Installationen. Aber ich denke, dies alles ist so oder wenig anders auch vom Betrachter diesen "Stellen des Feuers" abzulesen, wenn er sich meditativ auf sie einläßt wie Ismael auf das Wasser, wie überhaupt der Umgang mit der Kunst Dieter Göltenboths vor allem die Bereitschaft zur Meditation voraussetzt. Anders gesagt: Die Materialbilder und Installationen enthalten Leerstellen, in die der Betrachter eintreten muß, sollen sie ihm nicht verschlossen bleiben.
Damit komme ich zu meinem letzten Stichwort: der Insel. Daß Insel und Schiff miteinander in Verbindung stehen, liegt auf der Hand. Das voranstehende Zitat hat auch die "Stellen des Feuers" dieser - wenn ich es richtig sehe - das ganze Werk Dieter Göltenboths klammernden Metapher zugeordnet. In seiner Biographie und konkret ist dabei zunächst an Ibiza zu denken. Nicht - wie schon gesagt - als Ferienort, obwohl sich dort sein Tusculum eingerichtet hat, sondern als Projektion.
Wenn meine These von der Leerstelle stimmt, gilt sie insofern für den Künstler mit, als er in seine Insel als eine Leerstelle eintreten muß, soll sie mehr sein als nur eine Insel. Ich greife, um dies zu belegen, drei Arbeiten heraus: eine "Meerlandschaft", "Aus Tanits Wunderkammer" und die "Weiße Göttin". Zunächst sind es wiederum Materialbilder bzw. eine Materialskulptur ("Weiße Göttin"), für die das bereits Gesagte gilt: das Ordnen vorgefundenen, von Menschen bearbeiteten oder natürlichen Materials aus der Weltsicht des Künstlers. Aber was sich mit "Moby Dick" schon andeutete, verstärkt sich hier. Vor allem, wenn man die "Weiße Göttin" mit indianischen Totempfählen vergleicht, mit jenen geschnitzten und bemalten Pfählen, wie sie sich am eindrucksvollsten wohl bei den Tlingits ausgebildet haben, deren hierarchische Gesellschaftsstruktur sich auf matrilineare Klane stützte.
Auch die Göttin Tanit, Ibizas "Weiße Göttin" weist in die Zeit des Matriarchats zurück. Und dies ist mitangespielt, wenn Dieter Göltenboth seine "Weiße Göttin" nun zwar nicht mehr originär schnitzt und bemalt, sondern sie als Idee anspielt, wenn er gefundenes hölzernes Material so ordnet, daß es an Totempfahl oder hölzernes Götterbild erinnert und damit an eine Zeit, die Jean Paul seinem Quintus Fixlein im vermeintlichen Todeskampf, seinem Wuz auf das Sterbelager zurückholt, eine Zeit, die - nach Ernst Bloch - allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war.
(Dieter Göltenboth: Poetische Renaissancen. Kornhausgalerie Weingarten, 26.9.1993. Druck des überarbeiteten Textes u.d.T. "Vermutungen über Schiffe, Feuerstellen, Inseln und die Materialbilder Dieter Göltenboth s" in Katalog der Ausstellung Dieter Göltenboth s im Kunstverein Geislingen/Steige 1996, S. 2-10)

Reinhard Döhl
Siedeln an Abbruchkanten
Dieter Göltenboth hat seine Ausstellung ein wenig rätselhaft und scheinbar paradox "Siedeln an Abbruchkanten" überschrieben, rätselhaft auch deshalb, weil sich "Abbruchkanten" in keinem Lexikon nachweisen lassen.
Das Einladungsfaltblatt bildet eine kreuzförmige Arbeit ab, die "Strandkreuz" getitelt ist, mit der Materialangabe "Strandgut, Sand", und ein "Steinobjekt" mit der Materialangabe "Jurakalkstein, Roßhaar, Gips". Das Einladungsfaltblatt bildet also keinesfalls ab, was man immer noch als Kunststück, als Kunstwerk erwartet, sondern es verweist von vornherein deutlich auf Material und Fundstück, die sich durch die Arbeit des Künstlers zu etwas Neuem formen. Ich zitiere ergänzend aus einem kleinen Statement des Künstlers:
"[...] zivilisatorisches Material [mußte] zerbrechen [...] ehe aus dem Rest die neue Bildgestalt figuriert werden konnte.
Der Reiz des Vergänglichen (Materials) liegt ja gerade darin, daß das Zerfallen und Vergehen einen Prozeß sichtbar macht, der seine Lebendigkeit aus dem unaufhaltsamen Zeitprozeß zieht. Das Absterben des Alten ist die Voraussetzung für das Auferstehen in einem schöpferischen Akt."
Nichts anderes will - in einer ersten Leseschicht - auch der Titel der heutigen Ausstellung besagen, wenn er die Exponate als Belege begreift für eine Kunst, die von als "Siedeln" an "Abbruchkanten" verstanden wird, als künstlerische Arbeit mit ausschließlich dem Material, das die Abbruchkanten dem Siedler zur Verfügung stellen.
Das ist im Konzept nicht einmal so neu, sondern - wobei auf die Reihenfolge zu achten ist - bereits antizipiert in Hans Arps Forderung, der Dichter solle den Leser vor ein "sterbendes und werdendes Wortbild, vor eine sterbende und werdende Wortfolge" stellen. Dieser Formel vom "Sterben und Werden" korrspondiert an anderer Stelle die Formel von "Verwandlung und Werden", wenn Hans Arp für seine bildende Kunst festhält:
"In Ascona zeichnete ich mit Pinsel und Tusche abgebrochene Äste, Wurzeln, Gräser, Steine, die der See an den Strand gespült hatte. Diese Formen vereinfachte ich und vereinigte ihr Wesen in bewegten Ovalen, Sinnbildern der ewigen Verwandlung und des Werdens des Körpers."
Der Unterschied zu Hans Arp besteht darin, daß seine Fundstücke nicht mehr abzeichnet und in der Zeichnung vereinfacht, sondern daß er sie zusammensetzt und dergestalt verwandelt.
Was macht nun das Besondere, das Eigene der hier und heute gezeigten Objektkunst s aus, der, wie Heinz Hirscher, zu den in diesem Lande nicht seltenen, wenn auch viel zu wenig beachteten Doppelbegabungen zählt?
Ich beginne meinen Versuch, dieses Eigene und Besondere zu erklären, mit einem lakonischen Gedicht aus dem Jahre 1981, das , "Zum Mythos vom Ursprung" überschrieben hat. Es ist im Katalog zu dieser Ausstellung erstmals abgedruckt und lautet:
Adam kriecht aus seiner Höhle.
Er wälzt einen Felsbrocken
an die Stelle
wo einer seiner Söhne
erschlagen liegt.
Dann sammelt er die weißen Steine
und pflastert mit ihnen
den Platz vor der Hütte.
Durch den Nachthimmel
fallen Meteore.
Adam errichtet einen Schutzwall
aus großen Blöcken
während ihm Eva die Grütze kocht.
Später überlegen sie
wie es weitergehen soll.
Man könnte von diesem Gedicht direkt zur heutigen Ausstellung übergehen.
Metaphorisch stellt es, nach der Vertreibung aus dem Garten Eden und dem Brudermord Kains, die Frage nach Entwicklung und künstlerischer Produktion.
Konkret ließe sich von ihm zu den 'kosmischen' "Zentren" der 50er Jahre überleiten, deren runde Leerstellen sich dann als erloschene Sterne, als gefallene Meteore ansprechen ließen.
Denken ließe sich ferner daran, daß die Orientierung des Menschen im Raum zunächst anhand der Sternbilder erfolgte, was das für diese Ausstellung ausgelegte, gespiegelte Sternbild, aber auch die in den letzten Jahren entstandenen "Sternbilder" mit ins Spiel brächte.
Viertens ließe sich noch ein Bezug herstellen zu den "Steinbildern" der 80er Jahre, die - gleichgültig ob sie liegend oder hängend, wie in dieser Ausstellung, präsentiert werden - zweifellos mit den "weißen Steine(n)" korrespondieren, mit denen der Adam des Gedichts "den Platz vor der Hütte" "pflastert".
Die Ausstellung "Siedeln an den Abbruchkanten" versammelt also Werkgruppen aus den 50er, 80er und 90er Jahren, die zwar für sich betrachtet werden können, die aber zugleich im Zusammenhang gesehen werden wollen und dabei auch auf die biographisch-künstlerische Existenz ihres Hersteller verweisen.
Die Ausstellung setzt ein mit Arbeiten aus den 50er Jahren, als noch Schüler Willi Baumeisters an der Stuttgarter Kunstakademie war, den schon genannten "Zentren", die bereits ablesen lassen, daß es ihm von Anfang an um Betonung des Materials bzw. des Materialen und um Welt in einem umfassenderen Sinne ging.
Die folgenden 2 Jahrzehnte sind in nuce durch ein Exponat zusammengefaßt, dem den Titel "Kontinent" gegeben hat. Vom Material her eine angeschwemmte Polyesterplatte, Schuttreste, Reste von Fußbekleidung, faßt diese Arbeit in nuce die Aufenthalte der folgenden Jahre in Schweden, vor allem auf Ibiza und in Afrika (das sich denn auch im Umriß der Polyesterplatte andeutet), mit anderen Worten die 'Wanderjahre' zusammen, die der Zeit an der Akademie folgen und zur Selbstfindung führen werden. Wobei der gedankliche Spielraum, den alle Arbeiten s dem Betrachter öffnen, die "Spuren" einschließt, die der Wanderer hinterläßt, die oft nur noch andeutungsweise vorhanden sind, verschwinden oder gar verwischt werden.
Ein künstlerisches Ergebnis dieser Wanderjahre ist der endgültige Verzicht auf Malerei, die Entscheidung für das Fundstück, das Aufheben und neu Zusammenstellen, das - wenn man so will - Herstellen einer neuen Ordnung.
Was dies in Konsequenz bedeutet, zeigen die "Steinbilder" der 80er Jahre, bei denen einmal die Risse bzw. Sprünge in den Steinen als Grundgerüst der Komposition genommen werden, die zum anderen die gefundenen Steine unbehandelt neu miteinander komponieren zu Mauern oder Scheintüren oder Feuerstellen, nicht unähnlich den Arbeiten Adams in dem zitierten Gedicht, das nicht zufällig zur gleichen Zeit entsteht.
Ganz erschließt sich diese Werkgruppe allerdings erst, wenn man einen weiteren, den biographischen Bezug herstellt. wurde in Eybach geboren. Die "Abbruchkanten" des Ausstellungstitels sind geologisch gelesen der Albtrauf, die Abbruchkanten der Alb, von der denn auch die Steine nicht nur dieser Werkgruppe stammen. Biographisch gelesen sind die Arbeiten der 80er Jahre der Versuch einer Wiedervergewisserung von Heimat, einer Heimat freilich, von der wir in den Worten Ernst Bloch wissen, daß sie etwas ist, "das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war".
Fast wie ein Spiegel dieses Versuchs der Wiedervergewisserung ließe sich einer der großen gesellschaftskritischen, überdies in Stuttgart geschriebenen Romane lesen: Wilhelm Raabes "Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge" (1867), die Geschichte der Heimkehr des gescheiterten Theologiestudenten Leonhard Hagebuchers, nach langen Jahren irgendwo in Afrika, in seine Heimat nach Bumsdorf und dem benachbarten Residenzstädchen Nippenburg. Jahre später - und nicht mehr in Stuttgart lebend - läßt Wilhelm Raabe im "Stopfkuchen" den Romanhelden Eduard (Goethes "Wahlverwandtschaften" lassen grüßen) auf einem Schiff namens "Hagebucher" wieder nach Afrika zurückkehren, wo er von seinen Kindern empfangen wird mit der Frage, was er ihnen denn aus seinem Vaterland mitgebracht habe:
"Vader, wat hebt gij uns mitgebracht uit her Vaderland, aus dem Deutschland?"
Ich will diese auffällige Parallele hier nicht weiter vertiefen sondern wende mich wieder der Ausstelllung und ihrem Künstler zu. Wie wichtig der biographische Bezug seiner Kunst war und ist, belegte erst kürzlich ein Raum und Zeit verbindender Kubus zum 900jährigen Jubiläum Vaihingens, dem heutigen Wohnort des Künstlers, der sich aus 900 Findlingen von der Alb ordnete.
Bloch hat in seinem "Prinzip Hoffnung" das Paradies, als vom Menschen selbst zu schaffen, in einer nicht näher bestimmten Zukunft angesiedelt. Was einmal auf s Gedicht, seinen Schluß zurückverweist -
Später überlegen sie
wie es weitergehen soll -
zugleich aber andeutet, daß jede Vergewisserung von Heimat nur ein Durchgangsprozeß sein kann und immer zugleich einen neuen Aufbruch bedeutet. Auch hier ist es wieder ein Gedicht s, das sich in diesem Sinne lesen läßt:
Manchmal frag mich einer
was ich hier mache
und ich antworte:
ich bin eben hier.
Vor kurzem angekommen
bereite ich mich
auf die Abfahrt vor.
Man versteht weder
daß ich hier bin
noch daß ich aufbreche.
Vielleicht sollte ich
mit einem Fluch antworten.
Die Arbeiten der 90er Jahre lassen sich zunächst unter "Strandgut" subsumieren. Vom Meer Ausgeworfenes, am Strand von Ibiza, dem Fluchtpunkt s seit den 60er Jahren, Angespültes, Zerbrochenes bilden das Material dieser Arbeiten, die in der heutigen Ausstellung in exemplarischen Beispielen vertreten sind, wobei das auf dem Einladungsfaltblatt wiedergegebene "Strandkreuz" ein erstes Mal das Thema Tod nachdrücklich ins ästhetische Spiel bringt.
Auf den Stellenwert dieser Werkgruppe im Gesamtwerk habe ich bereits in den "Vermutungen über Schiffe, Feuerstellen, Inseln und die Materialbilder s" (1996) hingewiesen, darauf, daß sich z.B. die aus Strandgut gefügte "Weiße Göttin", "Tanit", indianischen Totempfählen vergleichen läßt.
Ergänzen möchte ich diesen eher ethnologischen Hinweis jetzt mit einen kunsthistorischen Bezug. Um den Titel der Ausstellung - "Siedeln an Abbruchkanten" - ein wenig aufzuhellen, hatte ich einleitend aus einem Statement s zitiert, dem zufolge "das Absterben des Alten [...] die Voraussetzung für das Auferstehen in einem schöpferischen Akt" ist, und ich hatte in einer ersten Leseschicht auf vergleichbare Überlegungen in der Kunstrevolution verwiesen.
Nach einer sicherlich von Hegel beeinflußten Unterscheidung des englischen Kunsthistorikers Lawrence Alloway verlaufen Kunstperioden in einer stets gleichen Abfolge: einer ersten Phase der Landnahme folgt als Zweites die Phase der "colonisation" (W.H. Auden), die schließlich und drittens in eine epigonale Phase mündet. Nehme ich Lawrence Alloway und beim Wort und übersetze - in einer zweiten Leseschicht - "colonisation" mit "Siedeln", würde sich Dieter Gölthenboth selbst der zweiten Phase einer Kunstperiode zurechnen, deren Wurzeln in der Kunstrevolution zu suchen wären. Auffällig sind dann freilich die "Abbruchkanten", denn sie markieren den Ort des Siedelns als gefährdet. Doch fände auch dies in der Kunstrevolution seine Parallele, indem die Avantgarde ihre Zeit als eine Zeit des Zusammenbruchs, ihre künftig gedachte Kunst als Vorstoß in eine terra incognita begriff.
Dies vorausgesetzt lassen sich Göltenboths "Weiße Göttin", sein "Strandkreuz" durchaus einigen dadaistischen Holzreliefs vergleichen, die von ihren Herstellern, Kurt Schwitters und Hans Arp, z.B. "Der breite Schnurchel" oder "Das Bündel eines Schiffbrüchigen" oder lakonisch "Bündel eines Da" genannt wurden. Diese witzigen Auslegungen dessen, was die Reliefs aus Fundstücken angeblich zeigen, sind aus der damaligen Zeit zu verstehen als provokative Adresse an den Betrachter, der auch angesichts dieser Arbeiten noch nach konventionellen Inhalten gründelte. In Wirklichkeit ging es aber vor dem Hintergrund einer aus den Fugen geratenen, als wahnsinnig empfundenen Zeit um Sinngewinn, um die sinnliche Qualität der gefundenen Materialien, um die ästhetische Erfahrung des Alterns und des Verfalls. Jedes der verwendeten Materialien hatte seine eigene Geschichte, brachte diese in das Relief und damit in einen neuen übergreifenden Kontext ein, ohne daß der Betrachter diese Geschichten konkret hätte entschlüsseln können. Von "Meditationstafeln" hat Arp in ähnlichem Zusammenhang gesprochen, von "Mandalas, Wegweisern", die "in die Weite, in die Tiefe, in die Unendlichkeit zeigen" sollten, während die weniger anspruchsvolle Kunstgeschichte von "Gedenktafeln" spricht, "die in unverständlicher Sprache von vergessenen Schicksalen erzählen" (Willy Rotzler).
Genau das scheint aber auch die entscheidende Erfahrung s zu sein bei der Lektüre der Spuren, welche Zerstörung, Abnützung und Zeit auf dem Holz oder anderem Strandgut hinterlassen haben. Was die Werkgruppe der frühen 90er Jahre dann leisten soll, ist, diese im Grunde unlesbaren Spuren, Mitteilungen und Geschichten des alten Holzes und anderer Fundsachen aufzunehmen und an den Betrachter weiterzuvermitteln in neuem Kontext und veränderter Form.
In veränderter Form meint dabei, daß es , wie übrigens schon Hans Arp und Kurt Schwitters, nicht um das surrealistische Objet trouvé geht. Wer seine Objektkunst für eine Ansammlung von Objets trouvés hält, verfehlt sie. Denn entscheidend ist, was er mit seinen Fundstücken macht, wie er sie zu einem Ganzen und damit zu seiner Lesart fügt. wobei der Zufall, was wiederum auf Hans Arp zurückverweisen würde, gelegentlich eine größere Rolle spielen kann.
Spielen in der Werkgruppe des "Strandguts" gefundene und gefügte Materialien eine Rolle, ist es in der letzten großen Werkgruppe der "Sternbilder" von der Erde genommenes / auf der Erde bereitgehaltenes organisches und anorganisches Material, mit dem jetzt seine Bilder 'malt': Blut, Erde, Sand.
Begonnen hatte dies bereits 1991 auf dem von zusammen mit einer Ethnologin geleiteten Symposion "Erde - Zeichen - Erde", an dem Wissenschaftler der Münchner Universität und bildende Künstler teilnahmen. Tagungsort war ein kurz zuvor aufgelassener Schlachthof in Straubing. Im Rahmen dieses Austauschs entstanden Arbeiten s, deren Material zunächst Blut und Lehmerde war.
Wenn eine dieser Zeichnungen, eine seltsam skurrile Figur, die im Sprung so etwas wie ein Ei verliert, "Der kleine Schöpfer" getitelt ist, bekommt ihr Material, Blut und Erde, einen eigentümlichen Hintersinn. Einen Hintersinn, der noch einmal "Zum Mythos vom Ursprung" zurückweist, der sich aber auch als Manifestation ihres Künstlers verstehen läßt in dem Sinne, daß künstlerisches Arbeiten, daß spontane Kreativität stets etwas aus sich heraus wirft.
Vielleicht auch deshalb werden auf den Arbeiten von in den letzten Jahren die Spuren ihrer Herstellung nicht mehr getilgt, lassen die Formfindungen den Prozeß ihres Entstehens immer deutlicher erkennen. Gleichzeitig werden die Arbeiten zunehmend zeichenhafter und figürlicher, wofür ich als Beispiele neben dem "Kleinen Schöpfer" noch den "Großen Sämann" oder den an Baumeister, den einstigen Lehrer, gemahnenden "Ballspieler" nenne.
Diese Zunahme an Zeichenhaftigkeit und Figürlichkeit geschieht nun freilich nicht so, daß jetzt zwischen Zeichnung und Bezeichnetem, zwischen Figur und Bedeutung die Gleichung einfach aufginge. Dagegen enthalten die Arbeiten immer noch zuviel an Anspielung, an tradierter Ikonographie, die gekannt sein wollen. Ja, die Arbeiten verlangen vom Betrachter gelegentlich sogar nachzuleistende Lektüre, sei es bei dem der Werkgruppe des "Strandguts" zugehörenden "Mobby Dick" [nicht in der heutigen Ausstellung], sei es in der heutigen Ausstellung das erst kürzlich entstandene "Heart of Darkness". Eine Arbeit, für deren Verständnis die Kenntnis von Joseph Conrads gleichnamiger Novelle unerläßlich ist, vordergründig einer autobiographisch untermauerten Reise Kongo aufwärts ins "Herz der Finsternis", psychologisch gesprochen und auf das mehrjährige Umherstreifen s auf dem afrikanischen Kontinent bezogen, einer Erkundungsfahrt durch die eigene Gegenwelt, die Dunkelheit seelischer Abgründe.
Das alles schließt sich wechselseitig nicht aus sondern belegt, allem ersten Anschein, jedem oberflächlichen Kurzschluß zum Trotz, s Objektkunst in ihrer Entwicklung als komplex, konsequent und geschlossen. Und noch einmal erweist sich ein kunsthistorischer Rückblick als hilfreich.
"Nicht nur der Farbe und der Leinwand, des Pinsels, der Palette, sondern aller vom Auge wahrnehmbarer Materialien und aller erforderlicher Werkzeuge" bediene sich seine MERZ-Malerei, hatte Kurt Schwitters festgehalten. Dabei sei es "unwesentlich, ob die verwendeten Materialien schon für irgendwelchen Zweck geformt waren oder nicht". Der Künstler schaffe "durch Wahl, Verteilung und Entformelung der Materialien" und erstrebe dabei "unmittelbaren Ausdruck durch die Verkürzung des Weges von der Intuition bis zur Sichtbarmachung des Kunstwerkes".
Diese Verkürzung des Weges vom Einfall zur Ausführung, die Unmittelbarkeit künstlerischer Produktion hat auch Hans Arp wiederholt betont und von einer "elementaren Kunst" gesprochen, die "den Menschen vom Wahnsinn der Zeit heilen", und in "eine(r) neue(n) Ordnung [...] das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle" wieder herstellen solle. Oder an anderer Stelle:
"Der Dichter kräht, flucht, seufzt, stottert, jodelt, wie es ihm paßt. Seine Gedichte gleichen der Natur. Nichtigkeiten, was die Menschen so nichtig nennen, sind ihm so kostbar wie eine erhabene Rhetorik, denn in der Natur ist ein Teilchen so schön und wichtig wie ein Stern, und die Menschen erst maßen sich an, zu bestimmen, was schön und was häßlich ist".
Das bringt mich zu meinen anfänglichen Überlegungen zurück. Und ich möchte, um diesen Bezug noch einmal anzudeuten und zugleich die eigene Position in dieser Tradition zu markieren, mit drei Aphorismen Göltenboths schließen, die zugleich als Motti der heutigen Ausstellung voranstehen könnten:
"Meine Gegenstände kommen aus der Natur. Oder sie kommen nicht aus der Natur, nehmen aber eine Naturmaske an."
"Entstehen, Vergehen, Konfrontation, Entfremdung, Maskierung sind einige Inhalte meiner Arbeit."
"Bilder entstehen in ihrer Zeit. Sie brauchen Zeit, um gemacht zu werden. Zeit kann sich in ihnen äußern. Zeichen des Entstehens, des Vergehens, des Aufbauens und des Zerfalls sind Zeitspuren wie die Spur im Sand."
(Südwestbank Stuttgart, 28.3.2001. Druck einer gekürzten Fssg. im Ausstellungskatalog)

Reinhard Döhl
Kunst Spuren Lesen
Zu einer Ausstellung von Arbeiten Dieter Göltenboths und Heinz H.R. Deckers in der Möglinger Zehntscheuer
Ihr – von Gruppenausstellungen abgesehen - erster gemeinsamer Auftritt, eine Performance und Installation zum Thema: „Armut und Reichtum - hier und anderswo“, 1989 in der Mannheimer Konkordienkirche, erregte Anstoß.
„Die ausgestellte Installation“, zitiere ich aus einer späteren Ausstellungseröffnung s, 1995 in Gauselfingen zu einem „WIR-Projekt“ Heinz H.R. Deckers,
„Die ausgestellte Installation aus 20 Anzügen, Brotlaib, Kreuzpuppe, Mehl, Holzstange, Seil sind wie Reliquien und zeugen vom Geschehen. Armut ist nicht schicksalhaft naturbedingt sondern gesellschaftlich bedingt, also hausgemacht. In dieser Ausstellung und Aktion an der ich mit einer Sperrmüll-Demonstration im Altarraum beteiligt war, und in der Decker und ich unsere Gestaltungen aufeinander abgestimmt hatten, kam es dann auch zum Eklat, als der Dekan diese Installation kurzerhand abhängen ließ. Das Interesse der Kirchen an heutiger Kunst stieß offensichtlich da an die Grenze, wo der Kirchgänger und Gläubige sich weigert, in so gestalteter Umgebung sein Abendmahl einzunehmen.“
Heute stellen beide Künstler zum zweiten Mal gemeinsam aus, nicht in einer Kirche sondern in einer Zehntscheuer und ohne Gefahr, vom Hausherrn abgehängt zu werden. Das bietet dem Interessierten die Möglichkeit, sich dem sperrigen Werk zweier Künstler zu nähern, die in ihrem Ansatz unterschiedlicher kaum sein könnten und deren Hervorbringungen sich dennoch aufregend ergänzen.
Von den Entstehungsdaten her umfassen die ausgestellten Arbeiten Deckers das Jahrzehnt von 1991 bis 2001, die Arbeiten Göltenboths, weiter ausholend, den Zeitraum fast einer Generation von 1970/71 bis 1997, wobei die Baleareninsel Ibiza den nun freilich keinesfalls touristischen Hintergrund bildet.
Ibiza als Fluchtpunkt
Ich möchte dies zunächst mit einer Anekdote belegen, und beziehe mich dabei auf eine von „Die Spur“, an anderer Stelle auch „Kontinent“ getitelte Arbeit von 1994/1995. Ihr ging eine gemeinsame Strandwanderung und Materialiensuche auf Ibiza voraus, auf der Decker das angeschwemmte Bruchstück einer Polyesterplatte aufhob und Göltenboth schenkte, der es dann Jahre später bearbeitete.
Vom Material her Bruchstück einer Polyesterplatte, Schuttrest, Reste von Fußbekleidung, faßt diese Arbeit gleichsam in nuce die „Wanderjahre“ s zusammen, die Zeit nach dem Stuttgarter Akademiestudium, die ihn nach Schweden, vor allem aber nach Ibiza und Afrika führten, das als Kontinent sich denn auch im Umriß der Polyesterplatte andeutet. Wobei der gedankliche Spielraum, den alle Arbeiten Göltenboths dem Betrachter öffnen, die „Spuren“ einschließt, die der Wanderer hinterlässt, die oft nur noch andeutungsweise vorhanden sind, verschwinden oder gar verwischt werden. Spuren, die zugleich Spuren einer Reise durch die eigene Gegenwelt sind, dem unbekannten inneren Afrika in Wilhelm Raabes "Abu Telfan" vergleichbar, einem in Stuttgart geschriebenen Roman, dessen weiterer Titel bezeichnenderweise "[...] oder die Heimkehr vom Mondgebirge" lautet.
Dieser „Kontinent“, bzw. „Die Spur“ getitelten Arbeit Göltenboths an die Seite stellen möchte ich einige ebenfalls in Ibiza konzipierte und entstandene Buchobjekte Deckers aus dem Jahre 1991, dokumentiert im Katalog des Projekts „Erde-Zeichen-Erde“. Sieben von ursprünglich 20 „Erdbüchern“ sind hier ausgestellt unter dem Titel „In der Erde kann man lesen wie in einem Buch“. Wobei zunächst offen bleibt, was denn in diesem Buch „Erde“ zu lesen ist.
Deckers Bücher sind keine realen Bücher, auch keine Attrappen, sondern aus Holz für diesen Zweck hergestellt, in Erde gepackt und mit gefundenen Steinen bestückt in einem doppelten Kontrast zum reichverzierten Bucheinband, den Prachtausgaben, die wir, aufgebahrt in den Museen und Bibliotheken als Teil unserer Kulturgeschichte hinter Panzerglas bewundern dürfen.
In doppeltem Kontrast, weil die Hüllen aus Stein und Erde zum einen den kunstvollen Bucheinband radikal banalisieren, zum anderen, weil sie als Material älter und langlebiger sind als das an den Menschen als seinen Hersteller gebundene Buch und damit eine Welt symbolisieren, in der der Mensch mutmaßlich eines Tages nichts weiter mehr sein wird als eine Ablagerung, Teil einer geologischen Schicht. So jedenfalls hat es Göltenboth in der schon genannten Ausstellungseröffnung gelesen bzw. in anderem Zusammenhang der in deutscher Sprache schreibende Tuwa-Nomade Galsan Tschinag unlängst auf den Punkt gebracht:
„[...] Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die menschliche Zivilisation sehr schnell zu Ende gehen könnte. Das Erzunglück der Menschheit besteht in ihrer Passivität angesichts der vielen Vorbereitungen zur Selbstzerstörung des eigenen Planeten. Als Verfechter des Schamanentums, als an das ganze Universum Glaubender könnte ich diesen Selbstmord des Menschen in Kauf nehmen. Der Mensch ist nur eine Gattung unter den Lebewesen. Wenn diese Gattung aus dem Leben verschwindet, werden dafür tausende anderer Gattungen weiterexistieren. Das klingt zwar grausam, enthält aber die letzte Wahrheit.“
Wenn auch die beiden Künstler Ibiza als „Refugium“ und zeitweiligen Arbeitsplatz gemeinsam haben, nutzen sie ihn durchaus unterschiedlich. Bezeichnenderweise stammt der Sand/die Erde der Deckerschen Buchobjekte nicht nur aus Ibiza sondern ist um Sand/Erde, die ihm von Freunden aus aller Welt zugeschickt wurde, ergänzt, während sich Göltenboth auf den inseltypischen Muschelsand und das Strandgut beschränkt, das das Meer ihm anschwemmt.
Viele seiner auf Ibiza entstandenen Arbeiten ließen sich zunächst unter "Strandgut" subsumieren. Zerbrochenes, vom Meer Ausgeworfenes, am Strand Angespültes bilden das Material dieser Arbeiten, die in der heutigen Ausstellung in exemplarischen Beispielen vertreten sind.
„In diesen [...] Arbeiten [...]“, hat Göltenboth schon 1969 in einer Ausstellungsnotiz festgehalten,
„In diesen [...] Arbeiten [...] war das Ausgangsmaterial angeschwemmter Zivilisationsschutt aller Art, Bretter, Keile, Kreisformen, Bleche, Puppenteile, zusätzlich verarbeitet mit Gips. Ich habe diese Dinge zu Ordnungen arrangiert, die meiner Vorstellung von Welt und Dasein entsprechen. Alles weitere läßt sich nicht sagen. Sie können es den Arbeiten entnehmen.“
Das Anordnen der Fundstücke, des aufgelesenen „Zivilisationsschutts“ wäre demnach die Sprache, in die der Künstler seine „Vorstellung von Welt“ übersetzt. Wieweit dieses Übersetzen zugleich ein Transformationsprozeß ist, wird deutlich an einer Vielzahl von kleinen Objekten, die Göltenboth unter dem Titel „Aus Tanits Wunderkammer“ im Nebenraum der Zehntscheuer wie Blätter eines Strand-Tagebuchs gereiht hat.
Wenn Göltenboth die Wunderkammer Tanit zuordnet, ordnet er sie der weißen Göttin Ibizas zu.
Wenn Göltenboth seine hier einschlägige Materialskulptur aber Tanit und nicht korrekt Tinnit titelt, belegt das für mich auch, daß es ihm nicht wie vielen zeitgenössischen Esoterikern um die Wiederbelebung eines alten Mythos geht.
Natürlich ist Göltenboths Materialskulptur der Weißen Göttin auch indianischen Totempfählen vergleichbar, jenen geschnitzten und bemalten Pfählen, wie sie sich am eindrucksvollsten wohl bei den Tlingits ausgebildet haben, deren hierarchische Gesellschaftsstruktur sich auf matrilineare Klane stützte. Denn Ibizas "Weiße Göttin" weist gleichfalls in die Zeit des Matriarchats zurück.
Wenn seine "Weiße Göttin" aber nicht mehr originär schnitzt und bemalt, wenn er gefundenes hölzernes Material so ordnet, daß es nurmehr in Fund- und Bruchstücken an Totempfahl oder hölzernes Götterbild erinnert, demonstriert er in diesem Vorzeigen zugleich einen unwiederbringlichen Verlust.
Von Engeln und Ratten
Dieser aus zerbrochenem „zivilisatorischen Material“ „neu [...} figurierten“„Tanit“ Göltenboths kontrastiert auf der Einladungskarte und in der Ausstellung ein mehrteiliges ‚realistisches’ Ensemble Deckers: „Sie war ein Engel“ (1996), für das, in modifizierter Form, immer noch gilt, was Decker 1974 für seine Material-Objekte festschrieb:
„Das Material-Objekt ist für meine Arbeit das geeignetste Ausdrucksmittel zur Darstellung einer realistisch gesehenen Umwelt.“
Denn „Sie war ein Engel“ spielt keinesfalls die Welt der alt- bzw. neutestamentarischen Engel samt ihrem volkstümlichen Bodenpersonal der Schutzengel in wie auch immer gebrochener Form an, sondern will ganz säkular und umgangssprachlich beim Wort genommen werden.
Was mich bei diesem aus den Realien Brautkleid, Blei, Röntgenbilder, Spiegel und Schwarzlicht gefügten Ensemble zusätzlich interessiert, ist ein Text Deckers, den ich zunächst zitieren darf:
zarter stoff und blei
HOCHzeit und tod
ein weisses brautkleid frivol
gepanzert durch eine bleierne korsage
röntgenbilder – krankheitsbilder
oben spiegel in denen sich keiner sieht
schwarzes licht das schattenlos verbindet.
Es ist dies ein Text, der beim ersten Hinhören lediglich die Realien zu rekapitulieren scheint, dem beim genaueren Lesen aber durch Wörter wie „zarter stoff“, „weißes brautkleid“, „frivol“, durch die „spiegel in denen sich keiner sieht“ und das „schwarze licht das schattenlos verbindet“ eine indexikalische Funktion bekommt. Auch um die Gefahr der Überspitzung möchte ich nämlich behaupten, dass diese scheinbar geringfügigen Erweiterungen reiner Materialangaben einen Kontext herstellen, in dem der Betrachter die von Künstler ausgewählten und arrangierten Materialien betrachten soll oder kann.
Wie auch immer erinnert dann der Dreischritt, die Dreiteiligkeit von Titel („Sie war ein Engel“), ausgestelltem Objekt und zugehörigem Gedicht an die Tradition der Emblematik, in der einem Lemma, einer Überschrift eine ausdeutende Pictura (in der Regel ein Holzschnitt oder Holzstich), und der wiederum eine Subscriptio, ein ausdeutender Text folgten.
Decker hat mir den Gefallen nicht getan, mehrere solcher Arbeiten auszustellen. Aber in einem übertragenen Sinne funktioniert meine These auch dann, wenn man bei Arbeiten wie „Der Tanz ums...“, bei „San Marco oder die Ratten des Himmels“ dem Betrachter die Arbeit zumutet, zu bzw. aus Lemma und Pictura seine Subscripto, seinen Text herauszulesen.
Wobei der gewissenhafte Betrachter sehr bald feststellen wird, daß sich die Exponate nicht schlackenlos auflösen lassen, daß sie widersprüchlich und unverhältnismäßig sind, z.B. zwischen Titel („Lied der Wölfe“) und Exponat (Sägeblätter für eine Kreissäge), zwischen einer angespielten Episode jüdischer Geschichte, einer angedeuteten Menora und den arrangierten Materialien des „Tanz[es] um...“
Vor allem bei „San Marco oder die Ratten des Himmels“ läßt sich dies gut zeigen, wenn der Betrachter erst bei zweiten Hinsehen zu den lebensgroßen ausgestopften Tauben auf bzw. am Fuße der Orgelpfeife auf dem Tabernakel den unverhältnismäßig kleinen Löwen von San Marco entdeckt und sich vielleicht erinnert, dass der „König der Tiere“ als Symbolfigur des AT vom Christentum übernommen wurde, wobei der geflügelte Löwe aus der Vision des Ezechiel zur Symbolfigur des Evangelisten Markus mutierte.
Diese zur Nippesfigur und zum Reisesouvenir verkommene Symbolfigur kontrastiert in der Installation mit zwei ihrer mythologischen Bedeutung völlig enthobenen Tauben, die als „Ratten des Himmels“ jedem, der je Venedig besucht hat, so oder so wohlvertraut sind, Hochzeitreisenden vor allem durch das obligatorische Erinnerungsfoto ans gemeinsame Taubenfüttern. Daß die „Ratten des Himmels“ eine weitere, antiklerikale Lesart zulassen, sei wenigstens angemerkt.
Das Haus des Dichters
Auch wenn Decker in erster Linie nur (bildender) Künstler ist, hat er für seine Perfomances gelegentlich Texte geschrieben oder in ihnen sogar funktionabel gemacht. Ich beschränke mich, um dies anzudeuten, auf die Waiblinger Performance „Uri Dhai – Die Rekonstruktion des Vergessenen“ aus dem Jahre 1992. In ihrem Fall sind auf einem Faltblatt den skizzierten Figurinen/Akteuren der Performance in Form von Subscriptiones ihre Rollen zugeschrieben, z.B. dem „durch den Kopf Reitenden“:
Der durch den Kopf Reitende ist einerseits
der unterdrückte tierhafte Verstand –
der deine Haut zu Markte trägt, oder sich
eintönig im Kreise dreht –
andererseits ist er das reduzierte rationale Bewusstsein –
vermeintlich alles überschauend;
oder der „Priesterin der vier Winde“, die zugleich die „Bewahrerin des Vergessenen“ ist. Sie befindet
sich in einem endlosen Sterben.
Zu allen Zeiten ist sie unwillkommen und
wird geächtet, denn sie bringt Vergänglichkeit,
aber auch das Vergessene zurück.
Sie ist kein Wesen aus Fleisch und Blut ihr
Körper manifestiert sich als Nebel, Dunst, oder Kraftfeld –
sie transzendiert die Grenzen der materiellen Welt.
In einem Kommentar hat Decker für seine Performance[s] die Traditionslinie über die Happening-Bewegung zurück bis zu den Auftritten der Dadaisten gezogen [Staufer-Kurier, 27.8.1992]. Direkt auf die Programme des Cabaret Voltaire in Zürich, auf Hugo Balls berühmte Verse ohne Worte verweisen, in wenn auch anderem Kontext, die von Decker im Verlauf der Performance selbst gesprochenen „vier Posaunen / (Apokalypse)“
1
en duri trant end donte, tra tu blod
regante drein, on dra lon
e grabon et ta lon, eg dra de wul
eg dra lo ras
2
e lando gron dol dasta din ronnla
gergi, in wonkra gill
3
da rando gifla so ka hilja, e lekko
dasja kischu on dra tilja
4
do kuru wan de oh, en la
jant du vu, en la jant du stra.
Kann man bei Decker vom Text zu Installation oder Performance kommen, denen er zugeordnet ist oder denen er als Bestandteil zugehört, führen Göltenboths Texte ein Eigenleben, auch wenn sie sich gelegentlich durchaus auf das künstlerisches Werk beziehen lassen. Ich möchte dies an einem Beispiel belegen, dem „Haus des Dichters“.
„Das Haus des Dichters“ gehört zu einer Reihe von Materialskulpturen, die 1970/71 auf Ibiza entstanden sind, einer Reihe, der bezeichnenderweise auch „Ein völlig leeres Gehäuse“ (nicht in dieser Ausstellung) zugehört. Die Materialien sind Holz, Drahtziegelgewebe, Gips, Spiegel, Bleiblech, Lack und Dispersionsfarbe, also nicht nur angeschwemmter „Zivilisationsschutt“ und Strandgut. Auch wirken beide Objekte (verglichen z.B. mit dem Exponaten „Aus Tannits Wunderkammer“) eher konstruiert als komponiert. Auf Göltenboths Biographie bezogen sprechen sie vom Antagonismus des Behaustseins und gleichzeitiger Unbehaustheit.
Diesem „Haus des Dichters“ lässt sich als später Kommentar ein in der Handschrift „Jan. 88 / Ibiza“ bezeichnetes Gedicht zuordnen:
Mein Meer,
ein stählernes Halbrund
das die Wellen zur Küste hinführt.
Mein Feld,
ein Turm im Meer,
von wo die Sirenen
noch immer
Odysseus locken.
Mein Haus,
das der Sonne zugewandte
und das mit der Nachtseite
in dem Sisyphus
gegen den Berg ankämpft.
In einem Dreischritt nähert sich der Text über das Meer („mein Meer“) der Insel („Mein Feld“) auf auf ihr („Mein Haus“) dem gefundenen Tusculum mit einer Tag- aber auch mit einer „Nachtseite“, jenem „unbekannten inneren Afrika“ vergleichbar, von dem schon die Rede war und in dem dann „Sisyphus gegen den Berg ankämpft“.
Göltenboth spricht nicht, was vielleicht näher läge, von seiner Kunst als Sisyphusarbeit, meint auch nicht, was vom alten Mythos umgangssprachlich noch geblieben ist: die sinnlose Anstrengung. Er spricht, wenn er vom Kampf gegen den Berg spricht, ausdrücklich den Mythos an, wie ihn Homer erzählt, für den Normalverbraucher Gustav Schwab in seinen "Sagen des klassischen Altertums" nacherzählt hat.
Seine moderne Auslegung hat dieser Mythos in einer kleinen aber gewichtigen Schrift Albert Camus', "Le Mythe de Sisyphe. Essai sur l'absurde" [Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde], erfahren in der Forderung, daß der von Gott verlassene und deshalb hilflos auf sich selbst zurückgeworfene Mensch trotzdem in [...] bewußtem Hinnehmen der absurden 'condition humaine' glücklich sein müsse“ [Gero von Wilpert, Lexikon der Weltliteratur].
„Ich sehe“ [schreibt Camus], „wie dieser Mann schwerfälligen, aber gleichmäßigen Schrittes zu der Qual hinuntergeht, deren Ende er nicht kennt. Diese Stunde, die gleichsam ein Aufatmen ist und ebenso zuverlässig wiederkehrt wie sein Unheil, ist die Stunde des Bewußtseins. In diesen Augenblicken, in denen er den Gipfel verläßt und allmählich in die Höhlen der Götter entschwindet, ist er seinem Schicksal überlegen“ [rde, S 99]. Und Camus folgert: „Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen“ [rde, 101].
Das gibt auch einigen Aphorismen Göltenboth in diesem Zusammenhang einen weiteren Sinn, wenn dort zu lesen ist:
„Feste undurchsichtige Wände, Flächen, scheinen etwas Endgültiges zu sein, schwer wegzuhacken. Hinter ihnen stehen wieder Wände.“ Oder: „Viele Räume nebeneinander, übereinander, hintereinander: unsere Gefängnisse im Raum.“
Die Rede ist vom „Haus des Dichters“. Das aber bewohnt in Personalunion auch der Künstler als Vertreter einer absurden Kunst, wie sie Camus in seinem Essai gefordert hat, wenn er „von dem absurden Kunstwerk“ das verlangt, was er „vom Denken“ verlange:
„Auflehnung, Freiheit und Mannigfaltigkeit. Dann wird es [das absurde Kunstwerk, R.D.] die tiefe Nutzlosigkeit manifestieren. In dieser täglichen Anstrengung, in der sich Geist und Leidenschaft mischen und gegenseitig steigern, entdeckt der absurde Mensch seine Disziplin [korr. aus „Zucht“, R.D.], die das Wesentliche seine Kräfte ausmacht. Der Fleiß, den er dazu braucht, der Eigensinn und der Scharfblick vereinigen sich so mit der Haltung des Eroberers. Auch Schaffen heißt: seinem Schicksal Gestalt geben. Alle diese Gestalten erklärt ihr Werk mindestens ebenso sehr, wie es durch sie erklärt wird. Der Komödiant lehrt uns: zwischen Schein und Sein gibt es keine Grenze“ [rde, 97]
Ich breche das Zitat hier ab, der Interessierte kann es selbst nachlesen, möchte aber wenigstens darauf hinweisen, daß sich weitere, z.T. recht konkrete Querverbindungen ziehen lassen z.B. über den „Moby Dick“ Melvilles, den Camus zu den „wahrhaft absurden Werken“ zählt [rde, 93] und dem Göltenboth im Jahre 1993 eine Arbeit widmet.
Die Ahnengalerie
Was ich abschließend noch zu belegen habe, ist die Annahme, daß bei aller Verschiedenheit ihrer Arbeiten Heinz H.R. Decker und dennoch aus derselben Wurzel kommen.
Ich habe bereits zitiert, daß Decker für seine Performance „Uri Dhai“ in einem Kommentar die Traditionslinie über die Happening-Bewegung zurück bis zu den Cabaret-Auftritten der Dadaisten gezogen hat. Direkt auf Marcel Duchamp Bezug nimmt das „Holzkleid“, das, als „Relikt“ in Möglingen ausgestellt, Duchamps berühmtberüchtigten „Akt, eine Treppe herabschreitend“ von 1911/12 zitiert und 1999 im Rahmen der Eßlinger Veranstaltung „Art à la mode“ in einer Performance von einem Model sogar vorgeführt wurde. Daß Elemente der Deckerschen Installationen gelegentlich an die ready mades Duchamps gemahnen, verwundert also kaum.
Bei Göltenboth wären vor allem Kurt Schwitters und Hans Arp als Ahnen zu nennen. Wobei sich dann Göltenboths "Weiße Göttin", die Fundstücke „Aus Tanits Wunderkammer“ durchaus einigen dadaistischen Holzreliefs vergleichen ließen, die von ihren Herstellern z.B. "Der breite Schnurchel" oder "Das Bündel eines Schiffbrüchigen" oder lakonisch "Bündel eines Da" genannt wurden.
Diese witzigen Auslegungen dessen, was die Reliefs aus Fundstücken angeblich zeigen, sind aus der damaligen Zeit zu verstehen als provokative Adresse an den Betrachter, der auch angesichts dieser Arbeiten noch nach konventionellen Inhalten gründelte.
In Wirklichkeit ging es vor dem Hintergrund einer aus den Fugen geratenen, als wahnsinnig empfundenen Zeit um Sinngewinn, um die sinnliche Qualität der gefundenen Materialien, um die ästhetische Erfahrung des Alterns und des Verfalls. Jedes der verwendeten Materialien hatte seine eigene Geschichte, brachte diese in das Relief und damit in einen neuen übergreifenden Kontext ein, ohne daß der Betrachter diese Geschichten konkret hätte entschlüsseln können.
Von "Meditationstafeln" hat Arp in andrem Zusammenhang gesprochen, von "Mandalas, Wegweisern", die "in die Weite, in die Tiefe, in die Unendlichkeit zeigen" sollten, während die weniger anspruchsvolle Kunstgeschichte von "Gedenktafeln" spricht, "die in unverständlicher Sprache von vergessenen Schicksalen erzählen" (Willy Rotzler). Beides ließe sich nach dem weiter vorne Ausgeführten auch für Göltenboth in Anwendung bringen.
In veränderter Form meint dabei, daß es , wie übrigens schon Hans Arp und Kurt Schwitters, nicht um das surrealistische objet trouvé geht, Heinz H.R. Decker nicht um das einzelne ready made. Wer Göltenboths Objektkunst für eine Ansammlung von objets trouvés, wer Deckers Arbeiten für eine Versammlung von ready mades hält, verfehlt sie. Denn entscheidend ist, was Göltenboth mit seinen Fundstücken macht, wie Decker mit seinen ready mades umgeht, wie sie sie zu einem Ganzen und damit zu ihrer Lesart, zum Lesevorschlag für den Betrachter fügen. wobei bei Deckers ‚Prosa’ das Kalkül, was wiederum auf Duchamp zurückverweisen würde, bei Göltenboths ‚Poesie’ der Zufall, was wiederum auf Hans Arp zurückverweisen würde, gelegentlich eine größere Rolle spielen können.
(Möglingen 23.11.2001)

Joachim Burmeister
Im Juni, unter den Lanzenstrahlen der Sonne, die Dachterrasse der Villa Romana, Panorama umher: Böcklin-Melancholie. Zypressen pilgern über die Hügellandschaft zum Horizont, Weihrauch-, Lorbeergeruch, Rosmarin-Parfum.
Unten im Panorama zittert Luft silbern auf den Dachpfannen von Florenz, reinster roter Puder sind all diese staubigen Ziegel. Eine Stadt aus sfumato, ein rauchiges, mit der Ferne verlorengehendes Florenz. Aber ganz hinten, hinter den einem immer wegspringenden Horizonten, muss Stuttgart liegen. Meine Stadt von 1958 bis 1969.
Überm Dachterrassentisch, aufgeschlagenes Buch mit Offsetabbildungen eines Stöhrer-Bildes von 1978, das den komplizierten Titel hat: "Wir erzählen einander Bruchstücke unserer eigenen, fremden Biographie". Gleich daneben ein Packen Gedichte von . Nicht herausgegeben. An manchem Blatt die lakonische Notiz "fraglich?"
Ich sehe das Panorama: Stuttgart 1958, 1960 ... Städte brauchen ja immer, wie Wein, einen Jahrgang, eine Datierung. Rom 1958 ist nicht Rom 2004, Wien bleibt auf keinen Fall Wien, eventuell ist Venedig 1938 einigermaßen Venedig 2004.
Damals beleuchtete das allermodernste Gebäude der Welt, der Fernsehturm, die Trümmerstadt mit seinen Lichtkegeln. Dieses Bruchstück Altstuttgart, Trümmerschlösser, auf deren Mauerkranz Gebüsch wächst: Über die Trümmerhügellandschaft zieht eine Fronleichnamsprozession mit Kirchenfahnen zur verletzten Russischen Kirche, Seidenstrasse.
Rauchig wie tanzende Luft über Florenz erscheint mir die Figur Göltenboth nach vierzig Jahren, zusätzlich zu dem Gedichtbüschel am Terrassentisch. Göltenboth, dessen Haupteigenschaft schien, still zu sein. Sprachlos, eventuell, weil er vieles sagen wollte und immer aufmerksam neben denen saß, die krähten.
Dass er Intensives meinte, merkte ich erstmals am Neusiedlersee, nahe der ungarischen Grenze. Dort hielt er drei Tage und eher Nächte hindurch einen Totenbestattungskongress zur "Totenentsorgung 2000", also einer nahen fernen Zukunft, ab. Als Statist: "Totenengel" durfte ich mit von der Partie sein; conferencierhaft vermittelnd zwischen auf Slowenisch geschluchzten Weinereien um Verstorbene und den Grabstelen-Collagen, die Göltenboth aus Bruchstücken unserer immer mehr werdenden Wegwerf-Welt in den Kellern dort arrangierte.
Danach verlor ich Göltenboth aus der Sicht. Außer einmal, 1964, beim Bergsteigen über die mondbeschienene, ziemlich hohe Umfassungsmauer einer römischen Villa, der Massimo. Göltenboth tappte herum - wusste ich von Gerüchten - auf Ibiza, in Afrika, auf Kuba, irgendwo zwischen Nairobi, Moskau, Herrenberg, der Alhambra und wohl allen Vorstädten Stuttgarts. Wie er, fliehend vor der Ausweglosigkeit der Zivilisation, tat ich auch: Nach Belgrad, Prag 64, oft nach Leningrad und Moskau 67-69, fünfmal dorthin ... Wir verloren uns aus den Augen, pathetisch gesagt: nicht aber aus dem herzlich gemeinten, gegenseitigen Wohlwollen, kurz: den Herzen.
An vielen Ecken dieser kaputten Topographie, in den nach Dammarharz riechenden Akademiesälen am Weissenhof, auch in einer erhalten gebliebenen Luxusvilla auf einem Hügelgrat oder im pathetischen Neorennaisance-Haus Galerie Müller, gären die Progresswünsche in den Künstlerköpfen.
Wo aber blieb da der vielen zu stille (aber nicht tatenlose) Göltenboth? (Übrigens zu solchen "Schweigern" rechne ich - mit Verlaub - auch mich, Tagebuchschreibfanatiker; so laut wie Esser oder Mader konnten wir gar nicht sein, und auch nicht so "links" brüllen.)
Dann, erst ganz kürzlich, lieferte er mir aus Wellpappe gemachte Florenzer-Domkuppeln, sehr mir zum Behagen, der ich seit 33 Jahren Heimatfreund dieser Gegend Firenze werden durfte. Und dann, scheu, vielleicht viel zu wenig frech, schickt er mir Gedichte hin. Dass es so etwas gab, wer konnte das wissen? Endlich kann ich einmal Göltenboth näher besichtigen! Quasi durchröntgen, heranzoomen, klar sehen. Seine Gedichte: getrockneter Fisch sind sie nicht. Sie maskieren nicht, sondern decken auf. Göltenboth: "Verdeckt man den Meerhorizont mit einem getrockneten Fisch, so maskiert man die Ferne."
Im Juni, unter den Lanzenstrahlen der Sonne, die Dachterrasse der Villa Romana, Panorama umher.
Geben wir uns, bitte, einen Augenblick mit Göltenboth ab!
Wie aus einer durcheinandergeratenen Diapositiv-Serie heben wir aus der Überfülle der Bilder dieser mir in der Hast durcheinandergeratenen Gedichte solche, sagen wir "Dias aus Worten", heraus, die uns am besten zu einem sightseeing der Göltenboth-Jahre passen. Ordnen wir die Puzzlestücke zu drei Dia-Serien zusammen, zu einer Kontur:
Was ist dem Göltenboth die Welt?
Was sind dem Göltenboth wir anderen auf der Welt?
Was ist dem Göltenboth: Göltenboth?
Wir selektieren einige Stücke, die oft von bildhafter Intelligenz sind.
WELT, GöltenbothISCH
"Die Ferne ist über mir"
"Nur künstliche Blumen blühen ewig gleich"
"Wind weht über raschelnde Gräser vom indischen Ozean her"
"Lilien blühen verdrossen"
"Ich finde nicht zurück aus Labyrinthen der Hohlwege"
"Ich fand meine Bilder am Wegrand, Kulissen der Zivilisation"
"Entzauberung, sprachlose Wiesen, wirre Angst"
"Inseln, schwarze Flecken unter mir"
"Unter dem Sternbild liege ich, mein Haus ist leer"
"Weder den Mond noch die Sterne werde ich betreten"
"In wachsender Erwartung des Unheils liegt verlassen der stille Strand"
"Das Ende ist ein schwarzes Loch, ein Kratersee im Urgestein, der Himmel und der Mangobaum - die fallen da hinein"
"Selbstgefertigte Wüste"
"Sommerrosen blühen ungesehen"
(Das Pantheon in Rom:) "Umgestülpt die Ränge eines griechischen Theaters"
"Meer frisst vom Strand und legt sich satt zurück ins Schaumbett"
"Wahrscheinlich ist Zeit: Wasser, gefroren in einem Glas"
UND WIR, ZIVILISATIONS-MENSCHEN, GöltenbothISCH
"Die verzweigten Höhlen der Städte"
"Mensch zwischen Gerümpel"
"Wer ist der große Zielsetzer?"
"Artikel Mensch - Jeder einzelne sucht sich herauszuheben"
"Leute: Sie wissen die Wege genau und rennen verzweifelt im Kreis"
"Die Modelle wechseln mit jedem Jahr, benommen lausche ich auf das gleichmäßige Rauschen"
"Die Stadt ist umstellt, keiner achtet darauf"
"Die Geliebte geht ohne Gruß"
"Hört Stimmen, die nichts sagen, in Sprachen, die er nicht versteht"
"Mein Name ist: ,Ich lache nie'"
"Die unbefugten Armen"
"Traum Afrika"
"Deutschland, das altbekannte Wintermärchenland"
"Geschichten vom wahren Glück, die allerfeigste Maske"
"Liebe versteckt sich auf dem Turm. Ihre Fahne weht über das ganze Land"
"Paris, steinernes Liebespaar"
"Kuba, wer hat gesiegt?"
"Das wachsbleiche Schneewittchen Moskaus - aufwachen zum Leben"
Göltenboth SIEHT Göltenboth
"Ich trinke aus der Sonne Hitze"
"Ich gewinne den Abend lieb"
"Kindlicher Hunger"
"Tänze des Vergessens"
"Ich finde meinen Weg nicht zurück"
"Ich suche Nähe"
"Ich bin wie Wasser und Licht - ohne Hass, ohne Liebe"
"Von meiner Heimat bin ich fortgeflogen und von dir, Liebste, auch"
"Ich bin Mensch - Ich kann nicht warten - Was jetzt nicht ist, ist nicht, wird niemals sein"
"Ich stelle den Antrag auf Schließung der Zeit"
"Betrachte deine Hand als Handlanger der Seele"
Jetzt, im Juli, bin ich über diese Göltenbothschen "Dias aus Worten" froh, sie hier auf der Terrasse über Florenz händereibend einheimsen zu können, in die Gemäldesammlung mit Leningrader Hängung in meinem Hirn, in die Sammlung von Sprechbildern, von Portraits der Welt aus Gedanken mit aufnehmen zu dürfen. Dicht gedrängt, Bild an Bild, Bild über Bild, wie die Göltenboth-Gedichte.
Selbst wenn ich von Göltenboth lediglich Bruchstücke aus seiner Biographie habe, Abbruchkanten aus 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, habe ich den Göltenboth ganz!
(Villa Romana, Florenz, Sommer 2004)

Günter Guben
DIETER GÖLTENBOTH - "EIN SERAPH DES VERDECKTEN DAZWISCHEN"
Rede anlässlich der Ausstellung Göltenboth / DÖHL in der Kulturhalle Tübingen vom 5. bis 26. September 2004 (Vernissage)
Im Halbbewussten eines frühen Morgens fiel mir plötzlich dieser Titel ein, und ich musste schnell nach Schreibmaterial suchen, um ihn festzuhalten, was im Gehen durch eine lebhaft frequentierte Einkaufstraße nicht leicht fiel.
Dieser Titel klingt kompliziert, doch ist er leicht entschlüsselbar.
Ein Seraph ist, nach dem Alten Testament, ein sechsflügliger Engel. Das ist Bedeutung genug.
Wenn der Künstler Göltenboth also zeichnet, malt oder Objekte fertigt, so ist auf den ersten Blick eigentlich alles zu sehen, was er getan bat.
Was aber hat er getan?
Er hat Oberflächen geschaffen, die einem auf geheimnisvolle Weise etwas vorenthalten, was hinter oder unter ihnen ruht. Vom Titel des jeweiligen Kunstwerks angefangen bis zur Durchführung wird man den berechtigten Verdacht nicht los: Hier geht es um etwas anderes, um viel mehr als das, was sich zunächst zu offenbaren scheint.
Das eben ist der Fall, und die Offenbarung besteht im Verdecken, im Tarnen dessen, worum es tatsächlich geht. Das heißt, dieses Dazwischen, eine Dimension, die Faktum und Fiktion verbindet, macht das Rätselhafte scheinbar dingfest, verstärkt jedoch nur die Neugier dessen, der als Rezipient "hinter die Dinge" schauen möchte. Dies setzt Gedankenflüsse in Gang, von deren Existenz man, bevor man eines der Kunstwerke gesehen hat, nichts gewusst, allenfalls geahnt hat, und die einem über die Neugier, mehr erfahren zu wollen, tatsächlich neue Erfahrungen zugänglich macht.
Auf diese Weise sieht man plötzlich mehr als nur das, was man zu sehen glaubt.
Der Seraph, ein Hüter wie Wegweisender, hat seine Aufgabe erfüllt.
Ich habe, um das kurz einzuflechten, meine erste Begegnung als Künstler - eine Zeitlang zeichnete, malte und stellte auch ich aus, es war hauptsächlich das Jahrzehnt zwischen 1980 und 1990 -, eine erste mir in der Erinnerung wach gebliebene Begegnung mit exakt vor 20 Jahren erlebt.
Das Institut Français de Stuttgart startete damals eine Aktion unter dem Titel "Double d'Électra" mit dem Musée d'Art de la Ville de Paris, die am 12. Januar 1984 von 17 bis 20 Uhr stattfand. - Vierzehn deutsche traten per Faxgerät in einem Wettstreit mit 15 französischen und amerikanischen Künstlern auf, schickten sich Originale hin und her, wobei die jeweiligen Ergebnisse entweder auswuchsen, reduziert wurden oder einfach mutierten.
Es war die damals erste internationale Demonstration für Kollektiv-Kunstwerke dieser Art auf elektronischer Basis, und ich weiß noch, wie der wohl eifrigste unter den Beteiligten war, und dass es uns allen Spaß gemacht hat.
Ich erwähne das, weil ich mich seit jener Zeit bemüht habe, das wachsende Oeuvre von Göltenboth im Auge zu behalten, denn schon damals haben mich seine Arbeiten fasziniert.
Von heute aus betrachtet und momentan kommentiert, muss man konstatieren, dass ein geheimnisvolles Faszinosum von den Exponaten ausgeht.
Erinnert man sich der Biographie des Künstlers, der bereits mit 26 Jahren das erste Mal nach Afrika reiste und fortan von Originalität und Kraft, von Menschen, Riten und Musik jenes Kontinents gleichsam infiziert wurde, so nimmt es nicht Wunder, dass starke Spuren im Werk sich immer wieder niedergeschlagen haben und auch heute und wohl künftig hin die Arbeiten dominieren werden.
Allein die Délicatesse des Umgangs mit Materialien und Farben verdient schon primäre Beachtung. Ich kenne nur wenige Künstler, denen die Verschmelzung eines Gegensatzes und seiner Aufhebung qua Ästhetik so unangreifbar überzeugend gelingt.
Nun mag der flüchtige Betrachter, respektive der, der Objekten oder Bildern s zum ersten Mal begegnet, sich ungewollt fragen, was das Künstlerisch-Eigentliche an ihnen sei, handelt es sich häufig doch um Elemente, deren ursprünglich völlig andere Funktion ihm durchaus erahnbar bleibt.
Die künstlerische Leistung Göltenboths besteht, so kann man mit Fug und Recht behaupten, in erster Linie darin, ein höchst subtiles Sensorium dafür zu besitzen, was man, isoliert man die Materialien aus der gewohnten Umgebung und fügt man sie nach, sagen wir, surrealistischen Prinzipien neu zusammen, auf diese Weise an Poesie zu potenzieren vermag. Und in der Tat, es handelt sich bei diesen Ergebnissen in Mehrheit um bildhaft gewordene Gedichte, Geschichten, Märchen und Mythen.
Macht man sich bewusst, was die diversen Titel der Kunstwerke als oft historisch-geschichtliche Fracht mitbringen, so kann man nur staunen, viel mehr noch, ich gehe so weit zu sagen: in heilige Verzückung geraten.
Das Dionysische, das Orgiastische, das allen Sinnesmenschen innewohnt, bis hin zum Gefahr bringenden Blick in Abgründe des Daseins, zeigt sich in vielen Arbeiten Göltenboths.
Er treibt das Spiel mit Sinnestäuschung, Anspielung auf seelische Untiefen oder Brachen des Unterbewusstseins so weit, dass man sich bei vertiefender Betrachtung seiner Kunstwerke mitunter gewaltsam in die Gegenwart, das momentan Seiende, zurückkatapultieren muss, um nicht in Trance davonzuschwimmen.
Diese Ausstellung zeigt brennpunktartig Exponate aus den Anfangsjahren Mitte der 50er, sodann frühe Objekte, also etwa von 1967 den vielfach beachteten und in die Beschreibungen, zum Beispiel Reinhard Döhls, eingegangenen "Nachen des Charon" bis hin zum allerneuesten Objekt, das eine an eine Antenne gefesselte Puppe mit durch Brand zerstörtem Gesicht vorführt.
Dazwischen liegen fast 50 Jahre, ein Zeitraum über gut eineinhalb Menschengenerationen.
Wie geht man um, wie soll, wie muss man umgehen mit derlei Dingen?
Ein Kanon von Antworten wäre möglich, was indes zeigt, dass ein objektives Rezeptionskonzept ebenso unmöglich wie unsinnig wäre, gäbe man es jemandem weiter.
Nein - es handelt sich bei der Betrachtung und ansatzweisen Analyse von Kunstwerken s um die schwierige Durchdringung von intellektuellem Verstehen-Wollen und unterschwelliger Besorgnis darüber, nicht als zu einfach Denkender eingestuft zu werden.
Diese Pole in die Konzeption seiner künstlerischen Arbeit miteinzubeziehen ist das womöglich Revolutionäre, auf jeden Fall fast jeden Beunruhigende des Künstlers.
Es ist wahrhaft prächtig, möchte ich betonen, dass uns so etwas beschieden ist.
Um nun nicht allzu viele Fragezeichen im Rahmen dieser Ausstellung zu installieren, seien einige, wenige Arbeiten herausgestellt und beleuchtet.
Boote und Türen spielen im Oeuvre s eine gleichermaßen wichtige Rolle. Schiffe und Boote tragen über ungeahnte Tiefen eines Flusses, eines Sees, eines Meeres hinweg, von Ufer zu Ufer, von einem gelebten Geschehen, einem Tatort zum andern, vom Diesseits ins Jenseits, wenn man die Symbolik ausgreifend ansetzen will.
Analog zum Phallus stößt ein Boot unter Umständen in unbekanntes Dunkel vor, taucht ein in etwas, das es zu erkunden gilt!
Es trägt den, der sich ihm anvertraut, zu neuem Erkennen.
- Die Suche nach Erkenntnis, ein Urgrund menschlicher Motivation, die Welt für sich zu sezieren.
Dafür unter anderem steht das älteste, hier ausgestellte Objekt "Nachen des Charon".
Charon, wie bekannt, ist nach der griechischen Mythologie der Fährmann, der die Toten über den Styx bringt.
Für den Werkteil, der sich mit Türen beschäftigt, sei das Objekt "Ausgang-Eingang" zitiert, eine Tafel mit Wächterfiguren, die zwei Funktionen besitzen: sie können den Durchgang erlauben oder verwehren.
Überhaupt stellt sich in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Frage: Was bedeutet Tür? Verbirgt sie etwas, was hinter ihr liegt, oder verwehrt sie demjenigen, der sich ihrer Funktion versichern möchte, das Verlassen des Raums, der Welt, in der sich der Akteur gerade befindet?
Dieses Dazwischen meine ich, zu Beginn meiner Rede benannt, das uns als Betrachter Göltenboth'scher Werke auf nie vollständig gesichertem Boden belässt, doch dazu anstachelt, alles genauer zu erkunden und zu erfahren.
Zum Thema "Mythen" gehören auch Arbeiten, die der Künstler mit Schweineblut und farbigen Erden, Sand, Ocker und dergleichen, geschaffen hat.
"Die weiße Göttin Tanit", eine Göttin der Phönizier, die von Karthago aus die Insel Ibiza als Toteninsel benutzten, ersteht immer wieder auf.
hält sich regelmäßig dort auf, um zu arbeiten, wie es ihm in Deutschland nicht möglich ist. Tanit erwacht von Zeit zu Zeit, und nicht nur sie. Das Figürliche war im Werk des Künstlers stets anwesend. Er selbst spricht davon, dass die Figur als surreale Körperlichkeit bereits in der bildhaften Übertragung solcher Begriffe wie Sonne, Meer oder ganz allgemein Landschaft, zu Figuration mutieren kann.
Als Schüler des großartigen Willi Baumeister, der sich seinerseits unter anderem auch mit dem Gilgamesch-Epos auseinandergesetzt hat, fiel es Göltenboth nicht schwer, Erkundungen in vorgenannter Weise weiterzuführen.
Befragt nach den Schritten, die zu einem Kunstwerk führen, nennt er deren vier:
1. Malerei,
das ist zum einen die Malerei pur, zum andern der Vorgang der Bemalung ausgewählten Materials;
2. Finden,
ich nannte bereits dieses Finden einen künstlerischen Akt;
3. Ordnen,
was wörtlich zu nehmen ist, denn im Vorgang des Ordnens erfährt das jeweilige in Arbeit befindliche Objekt seinem Thema gemäß die strukturell-ästhetische Ausprägung, und
4.) Feuer.
Zu diesem Punkt ist im weiteren Sinne natürlich auch Bleiblech zu zählen, eine Möglichkeit, Oberflächen total zu verfremden und das haptische Verlangen des Rezipienten in gewisser Weise irrezuführen.
Betrachtet man frühe Arbeiten s, so kann man den Übergang zur Collage fast von Beginn an erahnen, und folgerichtig führte er Anfang der 70er Jahre diese Collagen in die Dreidimensionalität über. Mittlerweile, man erkennt es unschwer anhand der zu betrachtenden Exponate, geht der Künstler so weit, dass er Miniatur-Bühnen baut, auf denen sich das Zweifelhafte, Komische wie Tragische unserer Existenz modellhaft und eindrücklich abspielt.
Als letztes Beispiel sei dafür das Objekt "Das Haus des Dichters" genannt, das mich nicht nur als Schriftsteller fasziniert.
In einem windigen Raum, wie man unschwer erkennen kann, also, wenn man will, in einem gefährdeten, lebt dieser Dichter, in einer Leere, die lediglich gedanklich gefüllt sein will, und, ja, welcher Künstler ist nicht Narziss, ein Spiegel weist auf die Fragwürdigkeit allen Tuns, aller Existenz hin.
Damit will ich's bewenden lassen; denn hier nun möchte ich die Verklammerung mit dem Wort-Poeten setzen.
Sein rechtzeitig zu dieser Ausstellung fertig gewordenes Buch An Abbruchkanten, das der rührige POP-Verlag in Ludwigsburg herausgebracht hat, weist Göltenboth als sensiblen, die Welt mit wachen Augen und klarem doch zugleich phantasievollem Verstand betrachtenden und einordnenden Dichter aus.
Freie Verse sind darin versammelt, aber, aufschlussreich für das Verständnis seiner bildnerischen Arbeiten, auch Notizen zu Themen wie Schönheit, Schmutz, Oberfläche oder allgemein Material.
Programmatisch dieses Gedicht:
Manchmal fragt mich einer,
was ich hier mache.
Ich antworte:
Ich bin eben hier.
Vor kurzem angekommen,
bereite ich die Abfahrt vor.
Man versteht nicht,
dass ich hier bin,
und nicht, dass ich aufbreche.
Stuttgart, Tübingen, Esslingen
20., 26., 30. und 31.8.2004

Klaus Siegle
Dieter Göltenboth: 70 Jahre und noch kein bisschen leise...
1949-2003 | Arbeiten aus fünf Jahrzehnten
Bislang konnte Stuttgart-Vaihingen nicht gerade durch ein üppiges Kulturangebot glänzen. Allenfalls auf ökonomischem Gebiet ragt dieser wirtschaftlich stark expandierende Stadtteil aus dem Mittelmaß heraus. Diesen Mangel an kultureller Vielfalt in dem fast 30000 Einwohner zählenden Teilort zu beseitigen – und nicht weniger – hat sich der Verein „Kultur am Kelterberg“ seit nunmehr vier Jahren zum Ziel erklärt.
Mit viel Eigeninitiative und bescheidenen, finanziellen Mitteln renovierten die Initiatoren des Vereins ein verwinkeltes, älteres Gebäude, indem sich zuvor das lokale Polizeirevier befand. So entstanden mehrere Ateliers, in denen Künstler mietfrei – man höre und staune! – arbeiten können. Darüber hinaus bietet eine Kunstschule Kurse zu verschiedenen künstlerischen Techniken an. Das umfangreiche Angebot wird durch eine Galerie abgerundet, wo sowohl ortsansässige als auch externe Künstler ausstellen. Zahlreiche interessante Ausstellungen und Aktionen hat es hier seit der Eröffnung 2000 gegeben, u.a. über zeitgenössische Kunst aus Ost-Afrika. Eine Graffiti-Kunstaktion im Mai 2002, stieß trotz der widrigen Wetterumstände auf reges Interesse.
Am Samstag, den 13. Dezember 2003, hatte nun der Verein zu einer Vernissage ihres 1. Vorsitzenden in Stuttgart-Vaihingen geladen. Dieter Göltenboth, der durch seine langjährigen Kontakte in der Kunstszene maßgeblich zum Erfolg dieses Vereins beigetragen hat, zeigt noch bis zum 27. Dezember über 70 Arbeiten aus seiner persönlichen „Schöpfungsgeschichte“ – wie der Einladungstext „augenzwinkernd“ verrät.
So vielschichtig wie seine beruflichen Betätigungsfelder, u.a. als Bildender Künstler, Kunsterzieher, Entwicklungshelfer und Kulturpolitiker, so unterschiedlich sind auch die künstlerischen Ausdrucksmittel (Papier, Ölbilder, Materialbilder aus Holz, Fundstücken, Plastiken, Druckgrafik, Fundstücke und andere Materialien) mit denen Dieter Gölteboth im Laufe seines Lebens gearbeitet hat. Dieser Prozess scheint bei weitem noch nicht abgeschlossen zu sein, wie im letzten Raum des Erdgeschosses deutlich wird. Dort hängt neben graphischen Arbeiten aus den 1960ern ein aktueller Siebdruck. Bei der „Weißen Göttin“ benutzte er ein ungewöhnliches Druckverfahren bei dem Leim und Sand zum Teil die Farbe ersetzten. Trotz der zeitlichen Spanne von über 40 Jahren fallen Ähnlichkeiten in Bezug auf Komposition und abstrakter Formensprache sofort ins Auge.
Außer Frage steht, dass an ästhetischen und oberflächlichen Spielereien nicht interessiert ist. Die bloße Wiedergabe von Erscheinungen ist für ihn Kunsthistorie, d.h. der Fotoapparat erfüllt diese Aufgabe heute viel besser. Am Anfang von s künstlerischen Entwicklung steht das autonome Kunstwerk, dass mittels einer abstrakte Formensprache ohne direkte Bezüge zur Wirklichkeit auskommt. Willy Baumeister, der große anerkannte Vertreter der abstrakten Kunst im Südwesten, wies ihn als Lehrer Anfang der 1950er in die Möglichkeiten der gegenstandslosen Malerei ein.
Auf Dauer erweist sich jedoch diese Bildsprache für das Anliegen s als ungeeignet. Schmerzlich vermisst er den Bezug zur Lebensrealität. Die Mittel der abstrakte Formensprache reichen nicht aus, um seine Vorstellung der Welt zu transformieren. Während seiner beiden ausgedehnten Afrikaaufenthalte in den 1960ern und 1970ern eignet sich eine lebendigere Bildsprache an, die mit Materialien und Formen experimentiert. Bewusst wird dabei der Symbolgehalt von Formen, Farben und Materialien zur Unterstützung der Bildaussage eingesetzt. Mythologische Anspielungen, sei es aus der Antike oder aus dem afrikanischen Kulturkreis, bringen tiefverborgene Seiten des Menschseins im Betrachter zum Klingen. s Arbeiten erscheinen uns als visualisierte Präzedenzfälle menschlicher Grunderfahrungen.
Auffallend sind die immer wiederkehrende Motive und Materialien, die als Ansatzpunkt zum tieferen Verständnis von s Arbeiten dienen können. So erscheinen häufig, in vielerlei Abwandlungen, das Kreuzsymbol und die Kreisform.
Durch diese Urformen (wie zum Beispiel bei der Abbildung eines Steinkreises) können mystische, mythologische und archaische Assoziationen beim Betrachter entstehen. Die Verwendung einfachster und vergänglicher Materialien wie Holz, Steine, Sand und Haare unterstreicht diese Wirkung.
Dies wird besonders deutlich an den Materialobjekten, die zumeist aus Fundstücken wie angeschwemmtes Holz, Strandgut, Zivilisationsschutt, Steinen, Haaren usw. arrangiert sind. Tief gefurchte Reliefs teilweise durch einen rechtwinkligen Rahmen begrenzt oder wie hier ohne Begrenzung, werfen unweigerlich Fragen nach Vergänglichkeit, nach Sein und Werden auf. Trotz aller Materialität erscheinen die Ordnungsprinzipien der abstrakten Kunst hier weiterzuwirken.
Nicht Brüche und abrupte Wechsel kennzeichnen s Werk, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, wobei die künstlerischen Medien je nach Fragestellung wechseln. Die Motive für sein künstlerisches Wirken stellt Dieter Gölthenboth eindringlich in seiner Eröffnungsrede dar, wo er die Bedeutung von Kunst und Leben für sich schildert. Wobei Leben für Ihn in erster Linie Überleben bedeutet.
Sich verbal den Arbeiten von zu nähern, fällt nicht leicht. Wo andere mit einfachen Aussagen und plakativen Motiven operieren, geben seine Bilder dem Betrachter Rätsel auf, die sich jedoch bei genauerem Hinschauen als lösbar erweisen. Das zu tun erweist sich als spannende und lohnende Aufgabe.
Letztendlich lassen sich nicht alle Bedeutungsebenen seiner Arbeiten vollständig entschlüsseln. Eine Rest von Mysterium bleibt in ihnen immer enthalten. Diese Gemeinsamkeit teilen sie mit dem Leben, wo einige Frage wohl auf ewig ungelöst sein werden.
Zum Abschluss einige Erklärungen von Dieter Göltenbolth aus den 1970ern zu seinen Arbeiten:
„Das Verhältnis von Ergreifen zu Verlieren. Die Fassbarkeit der Dinge und ihre Unfassbarkeit sind wichtige Aspekt meiner Arbeit.
Ich bemühe mich, „Bilder“ zu realisieren, die anfassbar sind. Sie lassen sich nun ergreifen, haben Körper und verdrängen Raum und bleiben doch ihrem Wesen nach unfassbar.
Je rätselhafter mir die Welt erscheint, desto mehr bleibt mir das „Bild“ als geeignete Metapher um Aussagen über das Dasein zu machen.“
Diese Retrospektive von macht jetzt schon neugierig auf seine nächste Ausstellung, die für dieses Jahr in der Kulturhalle Tübingen geplant ist.
Januar 2004
Erstveröffentlichung in
KULTUR EXTRA

Filder Zeitung, Juni 2005
Ausgedientem einen neuen Sinn geben. schafft Objekte aus Fundstücken - Arbeiten im Internet ausgestellt
Seit mehr als fünf Jahrzehnten tummelt sich Dieter Göltenboth auf den
verschiedensten Gebieten: Malerei und Zeichnung, Grafik, Siebdruck, Plastik,
Objektkunst, Installation und Performance. Vor knapp vier Wochen ist er
zurückgekehrt zu seinen künstlerischen Anfängen - der Formensprache. Erste
Ergebnisse dieses künstlerischen Schaffens können bereits wie in einer
Ausstellung im Internet betrachtet werden.
Schon während seines Studiums an der Stuttgarter Kunstakademie war Göltenboth
vom Kreis als Elementarform der abstrakten Malerei fasziniert. "Und nun ist es,
als ob ich schon lange nach dem gesucht habe, was hier genau vor mir liegt",
sagt der ehemalige Kunsterzieher am Fanny-Leicht-Gymnasium und deutet auf einen
Haufen Holzstücke. Dunkelbraun und verwittert liegen sie wild durcheinander
gewürfelt. Halb- und Viertelkreise, Längsstücke, Dreiecksformen und dazwischen
weitere Kreise - aus Holz gebogen.
Die Stücke stammen aus einer stillgelegten Keramikfabrik in Laveno Mombello am
Lago Maggiore. Dort wurden damit einst Gebrauchsgegenstände wie Waschschüsseln
und Vasen sowie Kunstgegenstände, beispielsweise Figuren, hergestellt. Gefunden
hat die "Schätze" ein Cousin Göltenboths. "Es sind archaische Zeugnisse einer
vergangenen Technologie", sagt der 71-Jährige. Aus diesen Fundstücken Neues
entstehen zu lassen, "ist der Reiz, der mich treibt und inspiriert".
Entsprechend seiner persönlichen Bilderwelt setzt Göltenboth die ausgedienten
Fragmente zu Objekten zusammen und gibt ihnen einen neuen Sinn: hier ein Magier,
dort ein Sonnengott und ein Krieger. "Ich erlebe den Arbeitsprozess wie einen
Schub, der Neuschöpfungen ermöglicht", sagt der Wahl-Vaihinger.
Neue Wege beschreitet Göltenboth mit seiner Ausstellung im Internet. Dort ist
die Arbeit an den Materialcollagen dokumentiert und jedermann zugänglich. "Für
mich als Künstler bietet das Internet die Möglichkeit einer permanenten
Ausstellung und gleichzeitig kann ich so weltweit präsent sein." Bei der
Umsetzung hat ihn der Computerspezialist Sergiu Stefanescu unterstützt.
Mittlerweile hat Göltenboth seine Homepage zum Werkverzeichnis ausgebaut, das
bis 1950 zurückreicht. "Jetzt muss ich nicht mehr nach einem bestimmten Bild im
Keller kramen, sondern habe es im Archiv."

Dietrich Heißenbüttel
Die postkoloniale Epoche: verschiedene Anfassungen von afrikanischer Kunst
Aus: "Afrikanische Kunst" – europäische Annäherungen, in: Tribus, Jahrbuch
Linden-Museum Stuttgart, Staatliches Museum für Völkerkunde, Band 55 – 2006, S.
80-82
Während europäische Künstler nach neuen Ausdrucksformen suchten, suchten die
Künstler der unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten nach eigenen
Standpunkten. Bis auf wenige Ausnahmen straften Europäer die unglaubliche
Vielfalt der in verschiedenen afrikanischen Ländern vor und nach der
Unabhängigkeit neu entstandenen Kunst mit einer dreifachen Missachtung: Erstens
schenkten sie ihr generell nur wenig Aufmerksamkeit. Zweitens konnten Afrikaner
für ihre Kunst nur einen Bruchteil der Preise erwarten, die europäische Künstler
erzielten. Drittens wollten Europäer von den Arbeiten, welche den Ansprüchen,
die sie an ihre eigene Kunst stellten, am nächsten kamen, am wenigsten wissen.
Afrikanische Kunst war „Kunst aus der Dritten Welt“.
Solche Kunst durfte, sollte naiv sein, bunt, farbenprächtig, ungelenk, eben
wie von Kindern, aber bitte nicht akademisch. Unter der Kapitelüberschrift
Müll-Phantasien schreibt Jürgen Grothues in einem Buch über „Recycling in der
Dritten Welt“ zu zwei durchaus reizvollen Patchwork-Arbeiten: „Auf Anregung
eines deutschen Beraters beim National Christian Council of Kenya (NCCK) wurden
diese textilen Bildapplikationen 1976 im Rahmen eines Projektes in Mathare
Valley - einem Slum bei Nairobi - eingeführt. Die Frauen, zum Teil Flüchtlinge
aus Somalia und Äthiopien, verwerteten Stoffreste aus der kenianischen
Industrieproduktion und von einheimischen Schneidern. [...] der gestickte
Kommentar zu einer traditionellen Musikerszene thematisiert das Nebeneinander
von Tradition und Moderne: ‚In der Vergangenheit hatten die Leute keine
Schallplatten-Tage (Discotheken) und tanzten statt dessen zu dieser Art von
Musik.“
Genau genommen handelt es sich hier nicht um einen Kommentar zum
„Nebeneinander von Tradition und Moderne“, sondern im Gegenteil zum
Traditionsverlust. Grothues idealisiert im Sinne der Ökologiebewegung der
siebziger Jahre als „Recycling“, was in Wirklichkeit einer Notsituation
geschuldet ist: Durch die Resteverwertung - von Müll oder Wiederverwertung kann
keine Rede sein - ließen sich die Investitionskosten des Projekts niedrig
halten, das in ökonomischer wie in künstlerischer Hinsicht von einem Nullpunkt
auszugehen hatte. Zudem verschweigt Grothues die Namen der Urheber des Projekts
und auch der Patchwork-Arbeit. Denn es handelt sich, wie in manch anderen
Fällen, keineswegs um eine „anonyme“ Volkskunst.
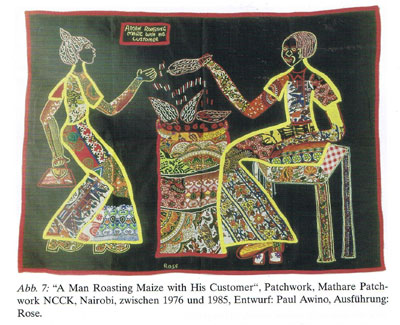
Der „deutsche Berater“ war der Stuttgarter Künstler Dieter Göltenboth, ein
Schüler von Willi Baumeister, der bereits um 1960 eine ausgedehnte Afrika-Reise
unternommen hatte und viele Jahre als Kunstpädagoge tätig gewesen war, bevor er
1975 in Kenia das Projekt ins Leben rief. Er wollte zunächst die eigene
Kreativität der 103 an dem Projekt beteiligten Frauen anregen, die jedoch, wie
sich herausstellte, über keinerlei zeichnerische oder handwerkliche
Vorkenntnisse verfügten. Dann meldete sich jedoch Paul Awino, ein Nachtwächter
am Nutrition Center, in dem die Workshops stattfanden, der gerne zu zeichnen
angab.

Von ihm stammen die meisten Entwürfe der Arbeiten, die fürderhin im Mathare Patchwork NCCK hergestellt wurden, einschließlich der beiden, die
Grothues in seinem Buch abbildet. Auch die Herstellerinnen der Stoffbilder sind
namentlich bekannt: Göltenboth legte Wert darauf, dass jede der Frauen
wenigstens ihren eigenen Namen zu schreiben lernte. Daher sind fast alle
Arbeiten, auch die zwei, die Grothues abdruckt, signiert.
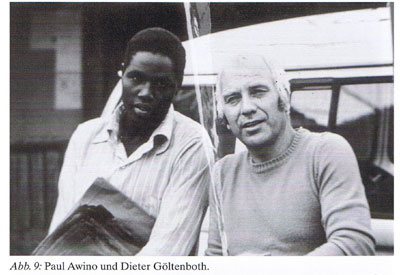
Es kann hier nicht darum gehen, 103 ungebildete Frauen aus einem Slum bei
Nairobi zu Künstlerinnen zu machen. Nichtsdestoweniger zeigen ihre Signaturen,
dass sich hinter den Bildwerken Subjekte und nicht einfach anonyme
Lohnarbeiterinnen verbergen, auch wenn es, wie Göltenboth betont, vorrangig um
das ökonomische Überleben der Frauen gegangen sei.
Auch der Entwerfer arbeitete
gegen Stücklohn, als Autodidakt, und beansprucht sicher nicht den Rang eines
„Künstlers“ im emphatischen Sinne. Seine individuelle Handschrift und sein
lebhafter, erzählerischer Stil bleiben gleichwohl jederzeit leicht erkennbar und
sind mit der folgenden Beschreibung nur unzureichend und irreführend
gekennzeichnet: „Die Motive spiegeln die Erfahrungswelt der Frauen wider:
Darstellungen von Frauen bei der Nahrungszubereitung knüpfen an althergebrachte
Lebensweisen an [... ] Schließlich verschweigt Grothues' neutrale Formel „auf
Anregung eines deutschen Beraters“, dass sich der Ansatz des einzigartigen
Projekts aus einer bestimmten kunstpädagogischen Tradition herleitet, der sich
Göltenboth als Baumeister-Schüler verpflichtet weiß.
Ich danke Dieter Göltenboth, der bei meinem Vortrag am 2.2.05 im
Linden-Museum anwesend war, für die ausführlichen Informationen und das zur
Verfügung gestellte Bildmaterial.
Dietrich Heißenbüttel
|