Stelle des Feuers
Landespavillon Stuttgart
8. - 30. April 1983
|
 |
Manchmal fragt mich einer,
was ich hier mache.
Ich antworte:
Ich bin eben hier.
Vor kurzem angekommen,
bereite ich die Abfahrt vor.
Man versteht nicht,
dass ich hier bin,
und nicht, dass ich aufbreche.
Vielleicht müsste ich mit einem Fluch antworten.
20. September 1975 |
|
 |
"Stelle des Feuers" ist der Ort der Einfriedung mit den
angesengten und zerbrochenen Stücken der "Welt", die zurückbleibt,
wenn die Jäger den Braten gegessen haben, wenn die aus der Flugbahn
gestürzten Vögel zu Dung geworden sind.
Es ist der Ort der Glut und der Asche, das Auge, das Loch, das, was
die Zeit überdauert.
Die "Stelle" ist eine Insel im Meer, ein Planet im All, ein
ausgewählter Garten, ein Hortus.
Der Hauch der Zeit weht aus der Glut. Die Geschichte der Evolution
als geologischer Ort der Versteinerung.
Ein Ort der Erinnerung, in dem die Zweifel nisten und knistern. Ein
verlassener Platz.
Ein leeres Denkgebäude. Ein Traum in Schwarz und Weiß. Eine
Schädelstätte. Der meditative Ort einer Aschenkultur, aus der wohl
nie ein Phönix steigen wird. Eher Begräbnisstätte, Landeplatz,
Deponie, Entsorgung, Ort des Aufbruchs, "Stelle des Feuers" ist
Melancholie, ist Aufhebung der Entwicklung, Anhalten, Einhalten,
Suche nach Zeitlosigkeit, Geschichtslosigkeit, Vergessen, Zuordnung
des Zeitlichen in das Unzeitliche.
Sieh, das Neue ist alt: es ist Kommen, Sein und Vergehen.
Doch gib der Kreatur die Hand, wenngleich alles vergeht.
Auch Ozeane sterben, Sterne vergehen.
Wir treiben im Lichtkreis des Augenblicks zwischen unendlichen,
fassungslosen Räumen.
24.02.1983 |
|
|
|
Was zwingt mich ja zu sagen zur Versteinerung?
Material und Form sind Metaphern. Sie sagen etwas aus über Existenz
und Bedingungen von Existenz.
Material als gefundene, vorgefundene Wirklichkeit, löst den Prozess
des Bildermachens aus.
Es geht mir um die Einordnung, Zuordnung, um den eigenen Standort.
Material haftet das Unerlöste menschlich-tierisch-organischer
Existenz an. Ich möchte es nicht transzendieren - im Gegenteil, ich
brauche es als Anker für den geistigen Höhenflug, damit der
Luftballon nicht entschwebt.
Es geht mir nicht darum, mich über die Erde zu erheben, sondern
darum, die Erde, erhoben wie sie ist, zu erkennen.
Dazu sind mir gerade die beladenen, verachteten, brüchigen, ja die
als unästhetisch belegten Materialien recht.
Schönheit und Hässlichkeit sind mehr moralische als ästhetische
Kategorien.
Was die Zuwendung zum Material so nötig macht, sind die Wirklichkeit
verdrängenden "Fortschritte" der Zivilisation ebenso wie die Flucht
in die Abstraktion.
Es muss in meiner eigenen Existenz begründet sein, dass mich die
Erscheinungen von Häuten, Oberflächen, Haaren, Dornen, von weißer,
ausfließender Farbe, von Steinen und Teer so sehr herausfordern. Ich
halte und benütze sie wie Beweise von Exis-tenz und wie Masken für
Inhalte, die unheimlich, ja beängstigend sind. Es ist fast so, als
ob ich mir durch das Vorweisen, Anfassen, Zuordnen von Material, das
aus der Welt stammt, das aus der Zivilisation kommt, das organisch
oder mineralisch ist oder auch künstlich, beweisen müsste, dass es
diese Welt, und mich in ihr, wirklich gibt. |
 |
|
Das Schöne an sich anzustreben halte ich für
Unsinn.
Schön wird etwas, weil es einer tiefen Notwendigkeit entspringt.
Die Vorstellung vom Schönen verändert sich ständig.
Wird etwas sinnentleert, so erscheint es als hässlich oder
veräußerlicht.
Dinge, die wir hässlich finden, sollten wir genau befragen.
Unsere Empfindung signalisiert uns den Ort, an dem wir stehen.
Dieser Ort kann ver-rückt sein.
Dann wäre es angebracht zu fragen, was wir tun müssen, um das
schön zu finden, was uns jetzt hässlich erscheint.
1972 |
 |
|
Schmutz
Schmutz ist ein gesellschaftliches Problem geworden. Der immer
saubere programmierte Mensch erzeugt solche Schmutzberge, dass er
beginnt darin zu ersticken. Frage: Wie kann die Sauberkeit so viel
Schmutz aufwerfen? Oder: Je mehr wir waschen, scheuern,
desinfizieren, desto schmutziger wird die Welt. Und dieser Schmutz
fällt buchstäblich auf uns zurück, so dass wir immer schneller immer
schmutziger werden. Je mehr Seife, desto mehr Schmutz.
Die Illusion unserer Reinheit zerfällt immer schneller, und sie wird
immer teurer erkauft.
Ist es nicht an der Zeit, den Schmutz anderswo zu suchen als auf der
Haut?
Der Schmutz, um den es wirklich geht, lässt sich nicht mit Seife aus
der Welt schaffen, auch nicht mit falscher Moral, Ideologie des
Schönen etc.
1972 |
 |
|
Haare
Haare heben sich nicht leicht auf. Sie wachsen noch ein wenig nach
dem Tode.
Sie markieren die Scham und nehmen dem Körper das Glatte, Abstrakte.
Die Kosmetikindustrie spricht von "lästigen" Haaren.
Was ist an Haaren lästig? Warum sind sie hier tabuisiert, dort
"lästig", auf dem Kopf aber erwünscht?
Haare üben auf mich einen großen Reiz aus. Hinter ihnen verbirgt
sich noch etwas Anderes, vielleicht etwas, das wir nicht wahr haben
wollen.
Vielleicht erinnern sie uns an etwas, das wir nicht sehen wollen.
1972 |
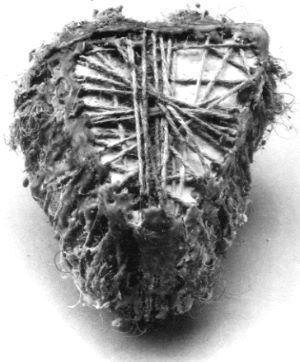 |
|
Inkarnation
Ich sehe im Materialbild die Möglichkeit, geistige Aussage zu
inkarnieren, um sie dadurch in der Welt zu verankern.
Material wird nicht dadurch veredelt, dass es sich vergeistigt,
sondern es ist edel, weil es selbst Inkarnation des Geistes ist. Es
gibt also kein unedles Material, ebenso wenig wie es einen vom
Körper gelösten Geist gibt. Dieser wäre nichts als ein Gespenst.
Geistigkeit, die sich so weit vom Boden entfernt hat, dass ihr die
Erde, der Körper, als ungeistiger Schmutz erscheint, ist nichts als
ein Phantom.
1972 |
 |
|
Die Stadt, in der ich wohne,
hat keine Tore,
ihre Fenster sind blind,
ihre Straßen geschlossen.
Zwischen Zyklopenmauern
aus rotem Geröll
gehen ihre Einwohner.
Unten steht der Fluss,
moosig,
alt,
ein Stück zerbrochenes Glas.
Der Fährmann wartet im Nachen,
zögernd folge ich seiner Einladung.
Weder im Fluss
noch auf den Wällen
sehe ich mein Bild.
Ich höre Stimmen,
die mir nichts sagen,
in Sprachen,
die ich nicht verstehe.
Sie gehen an mir vorbei
so, wie man an Steinen vorübergeht.
Die Stadt ist voll
vom Geschrei riesiger Vögel.
Tag und Nacht höre ich
den grässlichen Lärm,
den Kampf in der Luft,
die pfeifenden Schwingen.
Während ich im Boot
den Fluss überquere,
liegt sie im Zwielicht
unter dem stürzenden Himmel
ganz still.
Devon, 20. Sept. 1975 |
|
|
In meinem leeren Haus sind viele Zimmer,
in meinem großen Garten verdorren die Blumen.
Meine Fenster sind vergittert,
mein Garten ist tot.
In meinem großen Haus lebe ich allein.
In meinem toten Garten liege ich unter den Sternen.
Meine Sterne singen einen lauten Gesang
aus der Tiefe der Nacht.
Unter den fernen Sternen liege ich,
betroffen.
Mein Haus ist leer,
mein Garten ist tot,
meine Sterne fallen vom Himmel.
Nairobi 1976 |
 |
|
Das Ende war ein schwarzer Kasten,
in dem ein Stück vom Himmel hoch
gefangen blieb,
ein Stück vom Himmel
und ein Loch.
Die süße Mangofrucht lag dort,
im tiefen Schatten glänzte
an dem Ort das Grün so schwarz,
so honigsüß das Harz.
Ein Palmenwald am Meer,
ein lichter Busch,
du nahes Ende,
lichter Himmel hoch,
ich habe diesen einen Traum,
nur diesen noch.
Am Ende steht der Mangobaum,
ein Schattenloch in meinem Traum.
Ein kühler Schatten unterm Baum,
das ist mein Traum.
24.01.1979 |
 |
|
Eisiger Sturm aus der Seite des Mondes
Du trägts mich über den Abgrund
Du lässt mich tanzen
und schüttelst das Lachen aus mir.
Heute steht der Mond voll hinter mir
morgen das verhinderte Meer.
Heute drückst Du mich zu Boen
wie ein zitterndes Tier,
morgen schwebe ich auf deinem Rücken
über die magischen Kreise
über das Blöken der Herden,
über die Feuer der Tiefe.
Der gebeugte Wald
richtet sich nicht mehr auf,
aber ich stehe Dir lachend entgegen
und werfe mein Lachen gegen Dich.
November 1978 |
 |
|
|
|
|
|
|